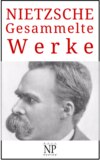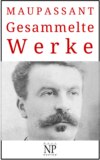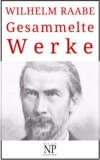Czytaj książkę: «Friedrich Wilhelm Nietzsche – Gesammelte Werke», strona 58
18
Der moderne Diogenes. – Bevor man den Menschen sucht, muß man die Laterne gefunden haben. – Wird es die Laterne des Zynikers sein müssen?
19
Immoralisten. – Die Moralisten müssen es sich jetzt gefallen lassen, Immoralisten gescholten zu werden, weil sie die Moral sezieren. Wer aber sezieren will, muß töten: jedoch nur, damit besser gewußt, besser geurteilt, besser gelebt werde; nicht, damit alle Welt seziere. Leider aber meinen die Menschen immer noch, daß jeder Moralist auch durch sein gesamtes Handeln ein Musterbild sein müsse, welches die anderen nachzuahmen hätten: sie verwechseln ihn mit dem Prediger der Moral. Die älteren Moralisten sezierten nicht genug und predigten allzuhäufig: daher rührt jene Verwechslung und jene unangenehme Folge für die jetzigen Moralisten.
20
Nicht zu verwechseln. – Die Moralisten, welche die großartige, mächtige, aufopfernde Denkweise, etwa bei den Helden Plutarchs, oder den reinen, erleuchteten, wärmeleitenden Seelenzustand der eigentlich guten Männer und Frauen als schwere Probleme der Erkenntnis behandeln und der Herkunft derselben nachspüren, indem sie das Komplizierte in der anscheinenden Einfachheit aufzeigen und das Auge auf die Verflechtung der Motive, auf die eingewobenen zarten Begriffs-Täuschungen und die von alters her vererbten, langsam gesteigerten Einzel- und Gruppen-Empfindungen richten, – diese Moralisten sind am meisten gerade von denen verschieden, mit denen sie doch am meisten verwechselt werden: von den kleinlichen Geistern, die an jene Denkweisen und Seelenzustände überhaupt nicht glauben und ihre eigne Armseligkeit hinter dem Glanze von Größe und Reinheit versteckt wähnen. Die Moralisten sagen: "hier sind Probleme", und die Erbärmlichen sagen: "hier sind Betrüger und Betrügereien"; sie leugnen also die Existenz gerade dessen, was jene zu erklären beflissen sind.
21
Der Mensch als der Messende. – Vielleicht hatte alle Moralität der Menschheit in der ungeheuren inneren Aufregung ihren Ursprung, welche die Urmenschen ergriff, als sie das Maß und das Messen, die Waage und das Wägen entdeckten (das Wort "Mensch" bedeutet ja den Messenden, er hat sich nach seiner größten Entdeckung benennen wollen!). Mit diesen Vorstellungen stiegen sie in Bereiche hinauf, die ganz unmeßbar und unwägbar sind, aber es ursprünglich nicht zu sein schienen.
22
Prinzip des Gleichgewichts. – Der Räuber und der Mächtige, welcher einer Gemeinde verspricht, sie gegen den Räuber zu schützen, sind wahrscheinlich im Grunde ganz ähnliche Wesen, nur daß der zweite seinen Vorteil anders als der erste erreicht: nämlich durch regelmäßige Abgaben, welche die Gemeinde an ihn entrichtet, und nicht mehr durch Brandschatzungen. (Es ist das nämliche Verhältnis wie zwischen Handelsmann und Seeräuber, welche lange Zeit ein und dieselbe Person sind: wo ihr die eine Funktion nicht rätlich scheint, da übt sie die andere aus. Eigentlich ist ja selbst jetzt noch alle Kaufmanns-Moral nur die Verklügerung der Seeräuber-Moral: so wohlfeil wie möglich kaufen – womöglich für Nichts als die Unternehmungskosten –, so teuer wie möglich verkaufen). Das Wesentliche ist: jener Mächtige verspricht, gegen den Räuber Gleichgewicht zu halten; darin sehen die Schwachen eine Möglichkeit zu leben. Denn entweder müssen sie sich selber zu einer gleichwiegenden Macht zusammentun oder sich einem Gleichwiegenden unterwerfen (ihm für seine Leistungen Dienste leisten). Dem letzteren Verfahren wird gern der Vorzug gegeben, weil es im Grunde zwei gefährliche Wesen in Schach hält: das erste durch das zweite und das zweite durch den Gesichtspunkt des Vorteils; letzteres hat nämlich seinen Gewinn davon, die Unterworfenen gnädig oder leidlich zu behandeln, damit sie nicht nur sich, sondern auch ihren Beherrscher ernähren können. Tatsächlich kann es dabei immer noch hart und grausam genug zugehen, aber verglichen mit der früher immer möglichen völligen Vernichtung atmen die Menschen schon in diesem Zustande auf. – Die Gemeinde ist im Anfang die Organisation der Schwachen zum Gleichgewicht mit gefahrdrohenden Mächten. Eine Organisation zum Übergewicht wäre rätlicher, wenn man dabei so stark würde, um die Gegenmacht auf einmal zu vernichten: und handelt es sich um einen einzelnen mächtigen Schadentuer, so wird dies gewiß versucht. Ist aber der eine ein Stammhaupt oder hat er großen Anhang, so ist die schnelle entscheidende Vernichtung unwahrscheinlich und die dauernde lange Fehde zu gewärtigen: diese aber bringt der Gemeinde den am wenigsten wünschbaren Zustand mit sich, weil sie durch ihn die Zeit verliert, für ihren Lebensunterhalt mit der nötigen Regelmäßigkeit zu sorgen, und den Ertrag aller Arbeit jeden Augenblick bedroht sieht. Deshalb zieht die Gemeinde vor, ihre Macht zu Verteidigung und Angriff genau auf die Höhe zu bringen, auf der die Macht des gefährlichen Nachbars ist, und ihm zu verstehen zu geben, daß in ihrer Wagschale jetzt gleich viel Erz liege: warum wolle man nicht gut Freund miteinander sein? – Gleichgewicht ist also ein sehr wichtiger Begriff für die älteste Rechts- und Morallehre; Gleichgewicht ist die Basis der Gerechtigkeit. Wenn diese in roheren Zeiten sagt: "Auge um Auge, Zahn um Zahn", so setzt sie das erreichte Gleichgewicht voraus und will es vermöge dieser Vergeltung erhalten: so daß, wenn jetzt der eine sich gegen den andern vergeht, der andere keine Rache der blinden Erbitterung mehr nimmt. Sondern vermöge des jus talionis wird das Gleichgewicht der gestörten Machtverhältnisse wiederhergestellt: denn ein Auge, ein Arm mehr ist in solchen Urzuständen ein Stück Macht, ein Gewicht mehr. – Innerhalb einer Gemeinde, in der alle sich als gleichgewichtig betrachten, ist gegen Vergehungen, das heißt gegen Durchbrechungen des Prinzips des Gleichgewichts, Schande und Strafe da: Schande, ein Gewicht, eingesetzt gegen den übergreifenden einzelnen, der durch den Übergriff sich Vorteile verschafft hat, durch die Schande nun wieder Nachteile erfährt, die den früheren Vorteil aufheben und überwiegen. Ebenso steht es mit der Strafe: sie stellt gegen das Übergewicht, das sich jeder Verbrecher zuspricht, ein viel größeres Gegengewicht auf, gegen Gewalttat den Kerkerzwang, gegen Diebstahl den Wiederersatz und die Strafsumme. So wird der Frevler erinnert, daß er mit seiner Handlung aus der Gemeinde und deren Moral – Vorteilen ausschied: sie behandelt ihn wie einen Ungleichen, Schwachen, außer ihr Stehenden; deshalb ist Strafe nicht nur Wiedervergeltung, sondern hat ein Mehr, ein Etwas von der Härte des Naturzustandes; an diesen will sie eben erinnern.
23
Ob die Anhänger der Lehre vom freien Willen strafen dürfen? – Die Menschen, welche von Berufswegen richten und strafen, suchen in jedem Falle festzustellen, ob ein Übeltäter überhaupt für seine Tat verantwortlich ist, ob er seine Vernunft anwenden konnte, ob er aus Gründen handelte und nicht unbewußt oder im Zwange. Straft man ihn, so straft man, daß er die schlechteren Gründe den besseren vorzog: welche er also gekannt haben muß. Wo diese Kenntnis fehlt, ist der Mensch nach der herrschenden Ansicht unfrei und nicht verantwortlich: es sei denn, daß seine Unkenntnis, zum Beispiel seine ignorantia legis, die Folge einer absichtlichen Vernachlässigung des Erlernens ist; dann hat er also schon damals, als er nicht lernen wollte was er sollte, die schlechteren Gründe den besseren vorgezogen und muß jetzt die Folge seiner schlechten Wahl büßen. Wenn er dagegen die besseren Gründe nicht gesehen hat, etwa aus Stumpf- und Blödsinn, so pflegt man nicht zu strafen: es hat ihm, wie man sagt, die Wahl gefehlt, er handelte als Tier. Die absichtliche Verleugnung der besseren Vernunft ist jetzt die Voraussetzung, die man beim strafwürdigen Verbrecher macht. Wie kann aber jemand absichtlich unvernünftiger sein, als er sein muß? Woher die Entscheidung, wenn die Wagschalen mit guten und schlechten Motiven belastet sind? Also nicht vom Irrtum, von der Blindheit her, nicht von einem äußeren, auch von keinem inneren Zwange her? (Man erwäge übrigens, daß jeder sogenannte "äußere Zwang" nichts weiter ist, als der innere Zwang der Furcht und des Schmerzes.) Woher? fragt man immer wieder. Die Vernunft soll also nicht die Ursache sein, weil sie sich nicht gegen die besseren Gründe entscheiden könnte? Hier nun ruft man den "freien Willen" zur Hilfe: es soll das vollendete Belieben entscheiden, ein Moment eintreten, wo kein Motiv wirkt, wo die Tat als Wunder geschieht, aus dem Nichts heraus. Man straft diese angebliche Beliebigkeit, in einem Falle, wo kein Belieben herrschen sollte: die Vernunft, welche das Gesetz, das Verbot und Gebot kennt, hätte gar keine Wahl lassen dürfen, meint man, und als Zwang und höhere Macht wirken sollen. Der Verbrecher wird also bestraft, weil er vom "freien Willen" Gebrauch macht: das heißt, weil er ohne Grund gehandelt hat, wo er nach Gründen hätte handeln sollen. Aber warum tat er dies? Dies eben darf nicht einmal mehr gefragt werden: es war eine Tat ohne "darum?" ohne Motiv, ohne Herkunft, etwas Zweckloses und Vernunftloses. – Eine solche Tat dürfte man aber, nach der ersten oben vorangeschickten Bedingung aller Strafbarkeit, auch nicht strafen! Auch jene Art der Strafbarkeit darf nicht geltend gemacht werden, als wenn hier etwas nicht getan, etwas unterlassen, von der Vernunft nicht Gebrauch gemacht sei: denn unter allen Umständen geschah die Unterlassung ohne Absicht! und nur die absichtliche Unterlassung des Gebotenen gilt als strafbar. Der Verbrecher hat zwar die schlechteren Gründe den besseren vorgezogen, aber ohne Grund und Absicht: er hat zwar seine Vernunft nicht angewendet, aber nicht, um sie nicht anzuwenden. Jene Voraussetzung, die man beim strafwürdigen Verbrechen macht, daß er seine Vernunft absichtlich verleugnet habe, – gerade sie ist bei der Annahme des "freien Willens" aufgehoben. Ihr dürft nicht strafen, ihr Anhänger der Lehre vom "freien Willen", nach euern eigenen Grundsätzen nicht! – Diese sind aber im Grunde nichts, als eine sehr wunderliche Begriffs-Mythologie; und das Huhn, welches sie ausgebrütet hat, hat abseits von aller Wirklichkeit auf seinen Eiern gesessen.
24
Zur Beurteilung des Verbrechers und seines Richters. – Der Verbrecher, der den ganzen Fluß der Umstände kennt, findet seine Tat nicht so außer der Ordnung und Begreiflichkeit, wie seine Richter und Tadler: seine Strafe aber wird ihm gerade nach dem Grad von Erstaunen zugemessen, welches jene beim Anblick der Tat als einer Unbegreiflichkeit befällt. – Wenn die Kenntnis, welche der Verteidiger eines Verbrechers von dem Fall und seiner Vorgeschichte hat, weit genug reicht, so müssen die sogenannten Milderungsgründe, welche er der Reihe nach vorbringt, endlich die ganze Schuld hinwegmildern. Oder, noch deutlicher: der Verteidiger wird schrittweise jenes verurteilende und strafzumessende Erstaunen mildern und zuletzt ganz aufheben, indem er jeden ehrlichen Zuhörer zu dem inneren Geständnis nötigt: "er mußte so handeln, wie er gehandelt hat; wir würden, wenn wir straften, die ewige Notwendigkeit bestrafen." – Den Grad der Strafe abmessen nach dem Grad der Kenntnis, welchen man von der Historie eines Verbrechens hat oder überhaupt gewinnen kann, – streitet dies nicht wider alle Billigkeit?
25
Der Tausch und die Billigkeit. – Bei einem Tausche würde es nur dann ehrlich und rechtlich zugehen, wenn jeder der beiden so viel verlangte, als ihm seine Sache wert scheint, die Mühe des Erlangens, die Seltenheit, die aufgewendete Zeit usw. in Anschlag gebracht, nebst dem Affektionswerte. Sobald er den Preis in Hinsicht auf das Bedürfnis des andern macht, ist er ein feinerer Räuber und Erpresser. – Ist Geld das eine Tauschobjekt, so ist zu erwägen, daß ein Frankentaler in der Hand eines reichen Erben, eines Tagelöhners, eines Kaufmannes, eines Studenten ganz verschiedene Dinge sind: jeder wird, je nachdem er fast nichts oder viel tat, ihn zu erwerben, wenig oder viel dafür empfangen dürfen – so wäre es billig: in Wahrheit steht es bekanntlich umgekehrt. In der großen Geldwelt ist der Taler des faulsten Reichen gewinnbringender als der des Armen und Arbeitsamen.
26
Rechtszustände als Mittel. – Recht, auf Verträgen zwischen Gleichen beruhend, besteht, solange die Macht derer, die sich vertragen haben, eben gleich oder ähnlich ist; die Klugheit hat das Recht geschaffen, um der Fehde und der nutzlosen Vergeudung zwischen ähnlichen Gewalten ein Ende zu machen. Dieser aber ist ebenso endgültig ein Ende gemacht, wenn der eine Teil entschieden schwächer als der andere geworden ist: dann tritt Unterwerfung ein, und das Recht hört auf, aber der Erfolg ist derselbe wie der, welcher bisher durch das Recht erreicht wurde. Denn jetzt ist es die Klugheit des Überwiegenden, welche die Kraft des Unterworfenen zu schonen und nicht nutzlos zu vergeuden anrät: und oft ist die Lage des Unterworfenen günstiger, als die des Gleichgestellten war. – Rechtszustände sind also zeitweilige Mittel welche die Klugheit anrät, keine Ziele.
27
Erklärung der Schadenfreude. – Die Schadenfreude entsteht daher, daß ein jeder in mancher ihm wohl bewußten Hinsicht sich schlecht befindet, Sorge oder Neid oder Schmerz hat: der Schaden, der den andern betrifft, stellt diesen ihm gleich, er versöhnt seinen Neid. – Befindet er gerade sich selber gut, so sammelt er doch das Unglück des nächsten als ein Kapital in seinem Bewußtsein auf, um es bei einbrechendem eigenen Unglück gegen dasselbe einzusetzen: auch so hat er "Schadenfreude". Die auf Gleichheit gerichtete Gesinnung wirft also ihren Maßstab aus auf das Gebiet des Glücks und des Zufalls: Schadenfreude ist der gemeinste Ausdruck über den Sieg und die Wiederherstellung der Gleichheit, auch innerhalb der höheren Weltordnung. Erst seitdem der Mensch gelernt hat, in anderen Menschen seinesgleichen zu sehen, also erst seit Begründung der Gesellschaft gibt es Schadenfreude.
28
Das Willkürliche im Zumessen der Strafen. – Die meisten Verbrecher kommen zu ihren Strafen wie die Weiber zu ihren Kindern. Sie haben zehn- und hundertmal dasselbe getan, ohne üble Folgen zu spüren: plötzlich kommt eine Entdeckung und hinter ihr die Strafe. Die Gewohnheit sollte doch die Schuld der Tat, derentwegen der Verbrecher gestraft wird, entschuldbarer erscheinen lassen: es ist ja ein Hang entstanden, dem schwerer zu widerstehen ist. Anstatt dessen wird er, wenn der Verdacht des gewohnheitsmäßigen Verbrechens vorliegt, härter gestraft, die Gewohnheit wird als Grund gegen alle Milderung geltend gemacht. Umgekehrt: eine musterhafte Lebensweise, gegen welche das Verbrechen um so fürcherlicher absticht, sollte die Schuldbarkeit verschärft erscheinen lassen! Aber sie pflegt die Strafe zu mildern. So wird alles nicht nach dem Verbrecher bemessen, sondern nach der Gesellschaft und deren Schaden und Gefahr: frühere Nützlichkeit eines Menschen wird gegen seine einmalige Schädlichkeit eingerechnet, frühere Schädlichkeit zur gegenwärtig entdeckten addiert, und demnach die Strafe am höchsten zugemessen. Wenn man aber dergestalt die Vergangenheit eines Menschen mit straft oder mit belohnt (dies im ersten Fall, wo das Weniger-Strafen ein Belohnen ist) so sollte man noch weiter zurückgehn und die Ursache einer solchen oder solchen Vergangenheit strafen und belohnen, ich meine Eltern, Erzieher, die Gesellschaft usw.: in vielen Fällen wird man dann die Richter irgendwie bei der Schuld beteiligt finden. Es ist willkürlich, beim Verbrecher stehen zu bleiben, wenn man die Vergangenheit straft: man sollte, falls man die absolute Entschuldbarkeit jeder Schuld nicht zugeben will, bei jedem einzelnen Fall stehnbleiben und nicht weiter zurückblicken: also die Schuld isolieren und sie gar nicht mit der Vergangenheit in Verknüpfung bringen, – sonst wird man zum Sünder gegen die Logik. Zieht vielmehr, ihr Willens-Freien, den notwendigen Schluß aus eurer Lehre von der "Freiheit des Willens" und dekretiert kühnlich: "keine Tat hat eine Vergangenheit."
29
Der Neid und sein edlerer Bruder. – Wo die Gleichheit wirklich durchgedrungen und dauernd begründet ist, entsteht jener, im ganzen als unmoralisch geltende Hang, der im Naturzustande kaum begreiflich wäre: der Neid. Der Neidische fühlt jedes Hervorragen des anderen über das gemeinsame Maß und will ihn bis dahin herabdrücken – oder sich bis dorthin erheben: woraus sich zwei verschiedene Handlungsweisen ergeben, welche Hesiod als die böse und die gute Eris bezeichnet hat. Ebenso entsteht im Zustande der Gleichheit die Indignation darüber, daß es einem anderen unter seiner Würde und Gleichheit schlecht ergeht, einem zweiten über seiner Gleichheit gut: es sind dies Affekte edlerer Naturen. Sie vermissen in den Dingen, welche von der Willkür des Menschen unabhängig sind, Gerechtigkeit und Billigkeit, das heißt: sie verlangen, daß jene Gleichheit, die der Mensch anerkennt, nun auch von der Natur und dem Zufall anerkannt werde; sie zürnen darüber, daß es den Gleichen nicht gleich ergeht.
30
Neid der Götter. – Der "Neid der Götter" entsteht, wenn der niedriger Geachtete sich irgend worin dem Höheren gleichsetzt (wie Ajax) oder durch Gunst des Schicksals ihm gleichgesetzt wird (wie Niobe als überreich gesegnete Mutter). Innerhalb der gesellschaftlichen Rangordnung stellt dieser Neid die Forderung auf, daß ein jeder kein Verdienst über seinem Stande habe, auch daß sein Glück diesem gemäß sei und namentlich daß sein Selbstbewußtsein jenen Schranken nicht entwachse. Oft erfährt der siegreiche General den "Neid der Götter", ebenso der Schüler, der ein meisterliches Werk schuf.
31
Eitelkeit als Nachtrieb des ungesellschaftlichen Zustandes. – Da die Menschen ihrer Sicherheit wegen sich selber als gleich gesetzt haben, zur Gründung der Gemeinde, diese Auffassung, aber im Grunde wider die Natur des einzelnen geht und etwas Erzwungenes ist, so machen sich, je mehr die allgemeine Sicherheit gewährleistet ist, neue Schößlinge des alten Triebes nach Übergewicht geltend: in der Abgrenzung der Stände, in dem Anspruch auf Berufs-Würden und –Vorrechte, überhaupt in der Eitelkeit (Manieren, Tracht, Sprache usw.). Sobald einmal die Gefahr des Gemeinwesens wieder fühlbar wird, drücken die Zahlreicheren, welche ihr Übergewicht nicht im Zustande der allgemeinen Ruhe durchsetzen konnten, wieder den Zustand der Gleichheit hervor: die absurden Sonderrechte und Eitelkeiten verschwinden auf einige Zeit. Stürzt aber das Gemeinwesen ganz zusammen, gerät alles in Anarchie, so bricht sofort der Naturzustand, die unbekümmerte, rücksichtslose Ungleichheit hervor, wie dies auf Korkyra geschah, nach dem Berichte des Thukydides. Es gibt weder ein Naturrecht, noch ein Naturunrecht.