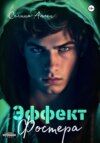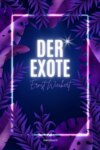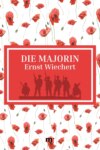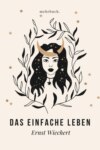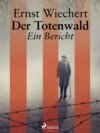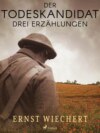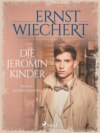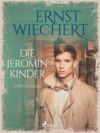Основной контент книги Im Totenwald

Objętość 150 stron
Im Totenwald
autor
Ernst Wiechert
399 ₽
8,67 zł
O książce
mehrbuch-Weltliteratur!
eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten.
Autobiographischer Bericht von der zweimonatigen Haft des Dichters im KZ Buchenwald. Ernst Wiechert war ein deutschsprachiger Lehrer und Schriftsteller. Von Anfang der 1930er bis weit in die 1950er Jahre hinein war er einer der meistgelesenen deutschen Autoren.
Gatunki i tagi
Zostaw recenzję
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka Ernst Wiechert «Im Totenwald» — czytaj fragment książki za darmo online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.