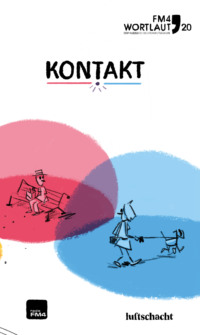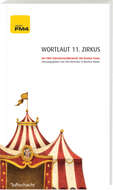Czytaj książkę: «FM4 Wortlaut 20. Kontakt»

WORTLAUT 20. KONTAKT
Der FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb. Die besten Texte.
Herausgegeben von
Zita Bereuter & Claudia Czesch

© Luftschacht Verlag – Wien 2020
Einzelrechte © jeweils bei den Autor*innen
Herausgegeben von Zita Bereuter und Claudia Czesch
Die Wahl der angewendeten Rechtschreibung obliegt dem/der jeweiligen Autor*in. Layout- und Formatvorgaben der einzelnen Texte wurden in der Regel beibehalten.
Covergestaltung: Albert Mitringer – @funkylikecottagecheese
Satz: Luftschacht, gesetzt aus der Metric und der Noe
ISBN: 978-3-903081-53-6
ISBN E-Book: 978-3-903081-82-6
Inhalt
VORWORT HERAUSGEBERINNEN
Zita Bereuter, Claudia Czesch
Berührender Kontakt
VORWORT JURY
Anna Weidenholzer
Am Anfang war ein Lampenschirm
PLATZ 1
Matthias Gruber
Hinter dem Mond
PLATZ 2
Johanna Hieblinger
Die Allergie
PLATZ 3
Elisabeth Etz
Stadt Land Fluss
PLATZ 4 (in alphabetischer Reihenfolge)
Katharina Feist-Merhaut
Jetzt, wo ich weiß, dass ich krank bin, jetzt wäre ich gerne
Tamara Imlinger
Drei Häuser am Waldrand
Sannah Jahncke
Glänzende Haare
Verena Kandler
Der Ausschlag
Nadine Keßler
Einundzwanzig Tage
Eva Krallinger
Fleischmachen
Tamara Schulz
Dunkelrote Designercouch
DIE HERAUSGEBERINNEN
Zita Bereuter, Claudia Czesch
Berührender Kontakt
„Eine gute Kurzgeschichte macht aus, dass sie mich berührt. Easy.“ Der Musiker und Juror Ariel Oehl gab seine klare Vorstellung im April bekannt. Das Interview fand – wie so vieles heuer – auf Distanz statt. Berührt haben die eingereichten Geschichten dennoch. 2020 – ein merkwürdiges Jahr – nicht nur für Wortlaut, den FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb.
2020 hat unseren Zugang zu „Kontakt“ völlig verändert. Das alles wussten wir aber Anfang April noch nicht, als wir um Kurzgeschichten zum Thema „Kontakt“ baten.
Wir schrieben damals von der merkwürdigen Aura, die den Begriff „Kontakt“ seit „wenigen Wochen umgibt“. Darüber, dass „die aktive oder passive Berührung des eigenen oder fremden Körpers“ neuerdings „unter völlig anderen Vorzeichen“ stehe. Nie hätten wir gedacht, dass diese Vorzeichen so hartnäckig bleiben. Von wegen Licht am Ende des Tunnels.
Wir hatten bewusst „Kontakt“ als Thema für Wortlaut gewählt. Wenn schon Lockdown, dann sollte umso mehr die Phantasie wandern, dann sollten unsere Hörerinnen und Hörer wenigstens über „Kontakt“ nachdenken und schreiben können. Möglicherweise war das für viele eine willkommene Ablenkung. Ob es am Thema lag oder daran, dass im Lockdown mehr Zeit zum Schreiben war, wissen wir nicht. Jedenfalls erhielten wir fast eintausendzweihundert Kurzgeschichten. Ein absoluter Rekord. Dafür herzlichen Dank!
Aufgrund der besonderen Umstände hatte dann auch die redaktionelle Vorjury mehr Zeit zum Lesen – die FM4 RedakteurInnen Zita Bereuter, Jenny Blochberger, Claudia Czesch, Ali Cem Deniz, Conny Lee, Sophie Liebhart, Maria Motter, David Pfister, Martin Pieper, Lisa Schneider, Simon Welebil und Jürgen Lagger vom Luftschacht Verlag. Das war bei den vielen Einsendungen auch nötig, wurden doch alle Texte mindestens zweimal gelesen. Bevor die Kurzgeschichten weitergereicht wurden, gaben wir telefonisch die Wertungen durch und markierten mit einem ausgefinkelten Farbsystem jede Einsendung. Nach wie vor lässt sich so leicht erkennen, dass Hunderte Texte drei-, vier-, fünfmal gelesen wurden. Die besten 80 dann von fast der gesamten Vorjury.
Aus diesem beeindruckend hohen Stapel die zwanzig besten Kurzgeschichten auszuwählen, fiel bei der Vorjurysitzung alles andere als leicht. Mit dem notwendigen Abstand bei viel frischer Luft wurde diskutiert und argumentiert. Und nach einigen Stunden war der Stoß dann auf zwanzig Texte reduziert.
Dieses Paket bekam dann die Jury – der Vorjahresgewinner Lukas Gmeiner, die Autorin und Aktivistin Nunu Kaller, der Songwriter und Musiker Ariel Oehl, der Autor und Kabarettist bei Maschek Robert Stachel und die Autorin Anna Weidenholzer.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die großartige Jury. Allesamt waren sie auch beruflich vom Lockdown schwer beeinträchtigt. Dennoch haben sie sich Zeit für Fragebögen und Interviews genommen, die zwanzig Texte gelesen und bewertet – und das alles ohne Honorar – mit viel Engagement für die Sache.
Noch nie hatten wir so wenig direkten Kontakt zur Jury. Selbst bei der Jurysitzung konnten sich nicht alle treffen. Reisewarnungen führten dazu, dass ein Teil in Wien saß, und der Kontakt zu Anna Weidenholzer in der Schweiz und Lukas Gmeiner in Berlin nur digital war. Technisch die bisher komplizierteste Wortlautjurysitzung, war das Dank einer äußerst unkomplizierten Jury dennoch machbar. Umso mehr musste konzentriert und geordnet zugehört und diskutiert werden.
Ganz klar einig war sich die Jury beim Gewinnertext Hinter dem Mond. Überzeugt hatte sie „die gute Mischung aus Schwere und Leichtigkeit“, die Art, „wie große existentielle Themen aufgerollt werden“, die Schreibweise, „ohne dass ein Wort zu viel verloren wird“, „die kluge Traumsequenz“, „das sprachliche Können“, das „Motiv des Astronauten“, und die Metapher von Hinter dem Mond, denn „das ist die dunkle Seite des Mondes, die immer da ist und die wir nicht sehen.“
Inhaltlich könnten die hier vorliegenden zehn Kurzgeschichten nicht unterschiedlicher sein: von einer Katzenallergie zu einem Rehkitz auf einem Trampolin, vom demenzkranken Vater zu der neuen Freundin mit Kind, zu einer Kassette mit Opas Stimme zu einem Mann, der sich mehr und mehr zurückzieht, von einer Therapiestunde zu einem blutigen Wochenende, von einer Schwangerschaft zu einem schwulen Frisör.
Was alle diese Texte eint: sie berühren.
Und das macht ja eine gute Kurzgeschichte aus.
Easy.
Claudia Czesch und Zita Bereuter
Am Anfang war ein Lampenschirm
Vor siebzehn Jahren saß ich an einem Herbstabend mit Freundinnen im Gasthaus Vorstadt, alle lebten wir erst seit kurzem in Wien. In meiner Erinnerung lag ein riesiger Raum vor uns, mindestens so groß wie die Welser Messehalle, zig Reihen an Stühlen, die Ausstellungsstücke jene zehn Menschen, die einzeln nach vorn gebeten wurden. Auch mein Name wurde aufgerufen. Ich stand auf, aufgeregt und stolz, und stieß mit voller Wucht gegen den Lampenschirm über mir.
Das war mein erster Auftritt als Autorin, auch wenn ich mich damals noch nicht so bezeichnet hätte. 2003 erreichte ich beim FM4 Wortlaut den neunten Platz, Vorletzte, aber das war egal, genau wie der siebzig Euro lion.cc Gutschein, den ich bekam, ich kann mich heute nicht einmal erinnern, was lion.cc überhaupt verkaufte. Aber dieser neunte Platz bedeutete mir damals, frisch nach der Schule, die Welt.
Was macht jemanden zur Autorin? Lesen und schreiben, klar. Aber auch das Hinaustrauen, der erste Zuspruch, der vielleicht irgendwann zu einer Veröffentlichung führt. Sich den Kopf stoßen, auf Zusagen hoffen und Absagen erhalten gehört ebenfalls dazu. Jurys sind im Leben einer Autorin ein seltsames Gebilde, das im Hintergrund Weichen stellt. Auf irgendeine Entscheidung wartet man immer, oft monatelang, und immer wieder tun sich neue Schranken und Übergänge auf.
Und dann kommt der Punkt, an dem die Autorin selbst in einer Jury sitzt und für das Vorwort der Anthologie etwas schreiben soll. Es ist uns nicht, tippe ich zuallererst und lösche diesen Satzbeginn sofort, weil zu erwartbar ist, was darauffolgt.
Aber anders lässt es sich nicht sagen. Es ist uns, der Jury, nicht leichtgefallen. Das hatte erwartungsgemäß mit literarischen Kriterien zu tun, aber auch mit den Eigenheiten dieses Jahres, kurzfristig erlassenen Reisebeschränkungen und Quarantänepflichten, technischen Schwierigkeiten. Ich bin mir sicher, keine Wortlaut-Jury vor uns hat so viel Zeit damit verbracht, eine Möglichkeit zu finden, einander zu hören.
Wir haben lange diskutiert und wieder von vorn begonnen, waren uns bei manchen Texten überraschend einig und bei anderen nicht. Lesen trägt immer auch den Versuch mit sich, zu verstehen, was einen ergreift und warum. Manchmal verliert man sich voll und ganz in einer Geschichte, manchmal ist es die Sprache oder Form, die einen einnimmt. Bei einer Jurysitzung wird diese Leseerfahrung noch weitergedreht, die Jurorin oder der Juror soll nicht nur verstehen, sondern auch erklären und werten. In der Literatur eine Reihung wie beim Skifahren zu vergeben, kann für alle Beteiligten grausam sein, formale gegen inhaltliche Kriterien abzuwägen, alles zusammen ein Ding der Unmöglichkeit.
Es liegt also in der Natur der Sache, dass uns die Entscheidung schwergefallen ist. Aber ich denke, unsere liebsten Zehn, die in diesem Buch versammelt sind, zeigen sehr gut, was uns fünf wild zusammengewürfelte Leserinnen und Leser auf eine bestimmte Weise ergriffen und begeistert hat.
Das Hören gelang uns nach den Anfangsschwierigkeiten einwandfrei, dass wir einander dabei auch alle sehen, gaben wir an irgendeinem Punkt auf. Nach unserer Jurysitzung, Stunden zwischen Wien, Berlin und Winterthur, schmerzten meine Ohren von den Kopfhörern. Ich klappte den Laptop zu und griff nach einem Buch, das auf meinem Schreibtisch lag. Alles muss seinen Himmel haben von Joseph Joubert, ein Autor, der sein Leben lang nur Notizen verfasste und den ich jeder und jedem ans Herz legen möchte. Planlos schlug ich das Buch auf und landete bei einem Eintrag aus dem Jahr 1816: Die Verrückten und selbst die zornigen Verrückten urteilen sehr gut.
In diesem Sinne, frohes Lesen.
Anna Weidenholzer
* 1984 in Linz, lebt in Wien. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft in Wien und Polen. Ist die beste Wortlaut-Wiederholungsschreiberin: 2003, 2008 und 2009 war sie unter den besten zehn Texten. Danach hat sie erfolgreich Bücher geschrieben: Der Sammelband Der Platz des Hundes (2010) sowie die Romane Der Winter tut den Fischen gut (2012), Weshalb die Herren Seesterne tragen (2016) oder Finde einem Schwan ein Boot (2019). Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien. Anna Weidenholzer wurde mehrfach ausgezeichnet oder auch nominiert – etwa für den Leipziger Buchpreis (2013) oder Longlist für den Deutschen Buchpreis (2016).
Im September 2020 ist sie auf Einladung des Verbands Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) in der Villa Sträuli in Winterthur zu Gast.
Hinter dem Mond

Foto: Miriam Kreiseder
Matthias Gruber
hat Theaterwissenschaft studiert, als man in der Uni noch rauchen durfte und macht seitdem immer irgendwas mit Medien. Vieles hat er dann auch wieder gelassen, aber das Schreiben ist ihm geblieben. Aktuell verbringt er seine Nachmittage auf Kinderspielplätzen und seine Abende mit der Arbeit am ersten Roman.
Ich stehe in der Küche und lege Münzen auf die Tischplatte. Zweihundert Ein-Euro-Stücke und eine rote aus Plastik mit dem Logo einer Supermarktkette. Als ich fertig bin, rufe ich nach Emma.
„Ich hätte gedacht, dass das mehr sind”, sagt sie beim Eintreten und nimmt einen Schluck aus ihrer Teetasse.
„Trotzdem unrealistisch, dass du die rote erwischt, wenn du einfach so hingreifst”, sage ich.
„Und die willst du jetzt so dem Arzt geben oder was?”
„Dann fahren wir eben vorher noch mal bei der Bank vorbei.”
Ich beginne, die Münzen zurück in den Stoffbeutel zu schieben, in dem normalerweise die Scrabble-Buchstaben liegen.
„Willst du ziehen?”, sage ich und schüttle. Im Beutel beginnt es zu klimpern.
„Lass das. Das bringt Unglück.”
Emma liegt mit ausgestreckten Beinen auf dem Behandlungstisch und hat das T-Shirt über den Bauch hochgerollt. Ich sitze daneben und drücke ihre Hand. Sie drückt zurück, aber nicht ganz so fest. Das Ultraschallgerät zerlegt Emmas Gebärmutter in schwarze und weiße Punkte und setzt sie am Monitor wieder zusammen.
„Ich seh da nichts”, sagt sie und lässt ihren Kopf nach hinten sinken.
Doktor Gruber dreht an einem der Knöpfe und wir hören den Herzschlag. Es klingt, als ließe jemand eine Springschnur über dem Kopf kreisen. Ich drücke Emmas Hand fester. Doktor Gruber dreht sich auf seinem Hocker nach einem Papierhandtuch um und reicht es ihr.
„Sie können sich wieder anziehen.”
Wir sitzen am Schreibtisch und Doktor Gruber tippt auf seiner Tastatur herum. Sein behaarter Unterarm hinterlässt auf der Glasplatte einen feuchten Abdruck. Als er fertig ist, dreht er den Bildschirm in unsere Richtung. Für den Computer ist Emmas Schwangerschaft eine Serie an Wahrscheinlichkeiten. Doktor Gruber überprüft eine Zahl nach der anderen. Die meisten nickt er wortlos ab. Andere kommentiert er beiläufig. „Herzschlag sieht gut aus. Hirnstamm unauffällig”, und so weiter.
„Unauffällig ist gut, oder?”, fragt Emma.
„Sie müssen sich das so vorstellen”, sagt Doktor Gruber und wechselt in den Modus für patientengerechte Sprache. „Der Fötus schwebt in der Fruchtblase wie ein Astronaut in einer Raumkapsel. Wir bekommen Hinweise, aber was da drin wirklich vor sich geht, wissen wir nicht.”
Emma nickt und ich denke, dass es am Ultraschall wirklich so ausgesehen hat, als würde das alles irgendwo im Weltraum passieren und nicht drei Zentimeter tief in ihrem Bauch.
Doktor Gruber macht in der Zwischenzeit mit den Zahlen weiter. Er dreht den Bildschirm noch ein Stück weiter in unsere Richtung, stützt sich am Glastisch ab und tippt mit dem Kugelschreiber auf das Display. „Das ist nicht das, was wir haben wollen.”
„Eigentlich blöd”, sagt Emma und rückt auf die Eckbank des Kaffeehauses.
„Was?”
„Na, ein Schreibtisch aus Glas. Da sieht ja jeder, was drunter ist.”
Ich denke nach, aber bevor mir ein guter Grund einfällt, müssen wir bestellen. Emma möchte Malakofftorte.
„Hab ich nicht mehr. Bienenstich oder Apfelstrudel“, sagt die Kellnerin knapp.
„Topfenstrudel?”, fragt Emma. Ich weiß, dass sie das absichtlich tut. Wenn man ihr Druck macht, stellt sie auf stur.
Die Kellnerin klopft mit dem Stift ungeduldig auf ihren Block. „Bienenstich oder Apfelstrudel”, wiederholt sie, diesmal ohne Fragezeichen.
„Es sind nur Wahrscheinlichkeiten. Das muss erst einmal gar nichts heißen”, sage ich.
„Eh. Aber es kann.” Emma sticht mit der Gabel ein Stück vom Strudel und balanciert es vor ihrem Gesicht. „Das Ganze nervt mich jetzt schon. Vor zwei Monaten wollten wir nicht mal Kinder und jetzt können wir übers Abtreiben nachdenken”, sagt sie und schiebt den Strudel in den Mund. Am Nebentisch bestellt eine Pensionistin viel zu laut Eier im Glas.
„Ich glaube, ich würde es schon kriegen wollen”, sage ich und greife nach Emmas Hand.
„Du kriegst es aber nicht. Ich krieg es”, sagt Emma und schneidet einmal mit der Kreissäge durch die Tischmitte.
In dieser Nacht fängt das mit den Träumen an. Ich befinde mich in einem Labor, das aussieht wie die Kommandostation eines Raketenflughafens. Ein nervöser Wissenschaftler beugt sich über seinen Monitor und wartet mit Zettel und Bleistift auf den Beginn einer Übertragung. Dann erscheint der Morsecode. Lauter x und y. Der Wissenschaftler schreibt angestrengt mit, aber er hat Mühe, dem Diktat zu folgen. Schweiß tritt ihm auf die Stirn. Als das Piepen aufhört, reißt er den Zettel ab und läuft hastig zu einem Computer neben einem hohen Glaskasten. Er tippt die Zahlen ein und auf der anderen Seite der Glaswand beginnt ein Roboter damit, scheibchenweise unser Kind zusammenzusetzen. Es blickt starr und leblos. Wie eine Puppe. Als der Roboter am Scheitel angekommen ist, fällt dem Kind der Kopf ab. Dann ein Arm, dann ein Bein. Ich bekomme Panik und bitte den Wissenschaftler, etwas zu unternehmen, aber er hebt nur hilflos die Arme. „Das sind die Chromosomen”, sagt er. „Alles ganz durcheinander.”
Als ich aufstehe, sitzt Emma schon in der Küche und stochert in ihrem Müsli herum. Ich öffne den Schrank, um eine Kaffeetasse herauszunehmen, aber es ist keine mehr da. Emma nickt Richtung Abwasch, in der sich das dreckige Geschirr stapelt. Wir haben nicht so viele Gemeinsamkeiten, dass es uns als Paar unsympathisch machen würde, aber wir teilen die Fähigkeit, eine dreckige Küche zu ertragen. Ich frage Emma, was das für Leute sind, die immer gleich nach dem Abendessen abwaschen und stierle mit den Fingern Salatblätter vom Boden des Spülbeckens, damit das braune Wasser abfließt.
„Leute wie unsere Eltern zum Beispiel”, sagt sie und beobachtet, wie ich mir die nassen Hände an der Jogginghose abwische. Ich befreie eine Tasse und den kleinen Kochtopf aus dem Geschirrturm, spüle beides ab und zünde das Gas an. „Immerhin mach ich mittlerweile die Milch für den Kaffee warm, das ist ja auch schon was”, sage ich und fülle eine Handbreit in den Topf. Es zischt, als die Milch das heiße Metall berührt.
„Scheiß Snob”, sagt Emma.
„Wie geht es dir heut?”, frage ich und starre in die Milch, die am Herd zu dampfen beginnt.
„Gut … so wie gestern”.
Ich weiß, sie findet es komisch, dass plötzlich jeder permanent nach ihrem Wohlbefinden fragt. Weil das ja auch bloß so ein Klischee ist, meint Emma, dass sich da von einem Tag auf den anderen weiß Gott was tut.
Ich nehme den Topf vom Herd und leere die dampfende Milch in meine Tasse. Die Milchhaut halte ich mit dem Zeigefinger zurück und schlecke sie dann ab.
„Wäh”, schreit Emma so laut, dass ich erschrecke. „Du bist ja wohl die grauslichste Drecksau überhaupt!”
Es ist mir nicht einmal aufgefallen. „Warum wäh? Am Pudding isst du die Haut ja auch.”
„Das ist ja nicht das Gleiche”. Sie hat Spaß daran, sich hineinzusteigern und schreit mich weiter an. „Wäh, wäh, ich kotze gleich das Kind raus!”
Jetzt muss ich lachen. Ich schlecke gleich noch einmal über den Finger und mache dabei ein Schmatzgeräusch. Emmas Augen sind tränennass vor Ekel und Lachen. Sie lädt einen Gupf Müsli auf ihren Löffel und katapultiert ihn in meine Richtung. Der Müslikloß klatscht gegen die Fliesen über dem Herd und schmiert langsam nach unten.
„Schaut aus wie ein Fötus”, sage ich.
Emma wischt sich die Tränen aus den Augen. „Ich glaube, mir reicht das nicht mit den Wahrscheinlichkeiten”, sagt sie. „Ich muss das wissen.”
Wissen bedeutet rein in die Raumkapsel, hat Doktor Gruber gesagt. Den Rest erklärt uns das Internet. Fruchtwasserpunktion tippen wir ein, Risiko Fehlgeburt denkt die Suchmaschine unsere Sorgen zu Ende. Eine Antwort hat sie auch. Schon wieder eine Wahrscheinlichkeit, eins zu zweihundert. So ein Loch in der Raumkapsel kann man unmöglich flicken.
„Stell dir vor, es hat gar nichts und dann stirbt es wegen der Untersuchung”, sage ich.
„Stell dir vor, wir machen es nicht und dann stellt sich im siebten Monat heraus, dass es behindert ist”, entgegnet Emma und dass eine Spätabtreibung noch viel schlimmer wäre.
„Nur weil es behindert ist, muss man aber nicht abtreiben”, sage ich.
„Ich kriege aber kein behindertes Kind, Johannes”, sagt Emma und verwendet meinen Vornamen als Rufzeichen. „Sicher nicht.”
„Ich wusste gar nicht, dass du das alleine entscheidest.”
„Na ja, du entscheidest es sicher nicht.” Sie streckt mir den Löffel entgegen wie einen Duellsäbel.
„Geiler Morgen schon wieder”, sage ich im Weggehen und knalle die Tür hinter mir zu. Viel zu heißer Milchkaffee schwappt über meine Hand.
Im Traum ist Doktor Grubers Spritze so dick und grau wie eine Stricknadel. Emma liegt am Behandlungstisch und er lässt die Nadel in ihren Bauchnabel gleiten. Ich wundere mich, wie leicht sie eindringt und dass es gar nicht weh tut. Emma ist ganz ruhig. Doktor Gruber stochert ein paarmal herum, dann sagt er „fertig”. Er zieht die Nadel heraus und wischt sie mit einem Papierhandtuch ab, wie den Ölmessstab eines Autos. Emma will sich aufrichten, aber Doktor Gruber drückt sie mit dem Arm zurück auf die Liege. „Bitte kurz noch liegen bleiben. Jetzt kommt noch die Fruchtblase raus.” Ich kriege Panik. „Was, das war schon die Abtreibung?" Zwischen ihren Beinen wird Emmas Hose blutig.
Es ist spät. Wir liegen im Bett und wischen uns durch Instagram. „Mir wird schon lauter Babyzeug angezeigt”, sagt Emma und hält mir ihr Smartphone hin. In der Story führt eine Frau in unserem Alter durch ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer.
„Ist die überhaupt schwanger?”, frage ich.
Emma nickt. „Viertes Monat oder so. Eh wie bei mir.”
„Sollten wir uns darum auch schon mal kümmern?"
Emma schüttelt den Kopf. „Die machen das jetzt, damit sie Sachen von den Firmen geschenkt bekommen.”
In der nächsten Story filmt eine Frau mit, als sie ihrem Freund erzählt, dass sie schwanger ist. Das Handy steht auf einem Stativ in der Ecke des Schlafzimmers. Sie umarmen sich und scheinen gar nicht zu merken, dass sie beobachtet werden. Ich erinnere mich, als Emma es mir gesagt hat. Kurz davor war ich auf dem Klo. Während wir uns umarmt haben, musste ich daran denken, dass an meinem Gewand vielleicht Klogeruch klebt und es den Moment ruiniert. Jetzt denke ich, dass genau das vielleicht den Unterschied ausmacht, zwischen uns und den Leuten im Handy.
„Stell dir vor, eine von denen kriegt ein behindertes Kind”, sage ich.
„Kriegen die nicht”, sagt Emma und knipst das Licht aus. „Passt doch gar nicht in den Feed rein.”
„Weißt du, woran ich immer denken muss?”, sage ich in die Dunkelheit hinein.
„Hm?”, antwortet Emma nach einer Weile, ohne sich zu mir umzudrehen.
„Neulich habe ich eine Doku gesehen über die Mondlandung.”
„So was schaust du?”, fragt Emma, aber ich erzähle einfach weiter.
„Da gab es die beiden Astronauten, die gelandet sind. Und dann war da noch ein dritter, den immer alle vergessen. Jedenfalls ist der, während die beiden anderen am Mond waren, einmal rundherum geflogen, um sie danach wieder abzuholen. Und auf der Rückseite vom Mond gab es nichts. Kein Funksignal, keinen Kontakt. Nichts. Er war ganz alleine im Weltraum. Der einsamste Mensch des Universums haben sie ihn in dieser Doku genannt. Aber wenn er nicht zurückgekommen wäre, dann wären die anderen beiden am Mond verloren gewesen.”
„Stimmt”, sagt Emma leise, obwohl das als Antwort eigentlich gar nicht passt. Vielleicht ist sie auch schon eingeschlafen. Aber dann sagt sie viel später doch noch etwas.
„Mich würde das freuen.”
„Was?”
„Na, wenn ich ganz alleine bin und auf der anderen Seite des Mondes warten zwei sehnsüchtig darauf, dass ich bald komme."
„Ich glaube, die haben sich nicht gefreut. Die hatten einfach eine Scheißangst”, sage ich.
„Vielleicht beides”, sagt Emma.
Am Samstag scheint die Sonne und wir machen einen Ausflug mit dem Rad. Danach kehren wir im Kaffeehaus mit der unfreundlichen Kellnerin ein. Ich fädle Möglichkeiten aneinander wie Perlen auf eine Kette. „Es kann immer sein, dass es gar nicht behindert ist”, sage ich. „Und wenn es behindert ist, dann kann es immer noch sein, dass es eine ganz leichte Behinderung ist. Etwas, mit dem man gut leben kann.”
„Wenn es behindert ist, will ich es nicht kriegen”, schneidet Emma die Kette ab und die Möglichkeiten kullern in alle Richtungen davon.
„Ich glaube, dass das wegen der Marie ist bei dir”, sage ich, ohne von meinem Kuchen aufzuschauen.
„Was?”, sagt Emma. Sie weiß, was ich meine, aber sie verschleppt ihre Antwort, um Zeit zu gewinnen.
„Na, dass man mit dir überhaupt nicht darüber sprechen kann.”
Emma antwortet nicht. Also rede ich weiter.
„Du hast selbst gesagt, dass es bei deinen Eltern damals nicht an ihr gelegen hat.”
„Es spielt aber keine Rolle, an wem es gelegen hat, weil das Resultat dasselbe war”, sagt sie.
Ich gebe nicht auf. „Deine Mama sagt immer, dass sie rückblickend froh ist, dass sie die Marie damals bekommen hat.”
„Ja, weil rückblickend jeder über alles froh ist.” Emma legt ihre Gabel ab und schiebt den Teller mit dem Kuchen weg. „Ich war aber dabei. Ganz unrückblickend. Und da war sie noch nicht froh, irgendwie und eigentlich. Da war es einfach nur Scheiße.”
Emma hält das Gespräch für beendet, aber ich will nicht. Ich sage, dass das unsere gemeinsame Entscheidung sein sollte und dass ich nicht ihr Vater bin.
„Das kannst du jetzt leicht behaupten.” Sie lehnt sich mit ihrer Kaffeetasse im Sessel zurück.
„Was du mir zutraust”, sage ich.
„Na ja, mein Vater ist ja nicht der Einzige, der jemals seine Familie verlassen hat. Es ist einfach eine Tatsache, dass Frauen am Ende oft alleine dastehen”.
„Jetzt mach nicht wieder so eine scheiß Feminismusdiskussion draus!”
Das war zu viel. Emma knallt ihre Tasse auf den Tisch, steht auf und geht. Die Kellnerin schaut ihr von der Theke aus ratlos hinterher. Zahlen bitte, deute ich in ihre Richtung. Sie kassiert, geht grußlos davon und schüttelt den Kopf. Ich frage mich wirklich, warum wir immer wieder hierherkommen.
Emma steht am Parkplatz gegen einen blauen Family-Van gelehnt. Sie hat den Kopf in den Nacken gelegt und sieht nicht mehr wütend aus, nur traurig. Ich stelle mich zu ihr und wir schweigen eine Weile.
„Weißt du, was wirklich beschissen ist? Ich kann nicht mal eine rauchen.”
Kurz überlege ich, ob ich ihr eine Zigarette aus meinem geheimen Vorrat anbieten soll, aber dann lasse ich es. Ich sage, dass es mir leid tut und dass das neu ist. Dass die Dinge uns früher immer beide gleich betroffen haben und plötzlich betreffen sie einen mehr. Das ist ungewohnt. Sie sagt, bitte machen wir die Untersuchung, ich kann das sonst nicht, und ich sage, natürlich machen wir es. Da gibt es gar keine Diskussion.
Darmowy fragment się skończył.