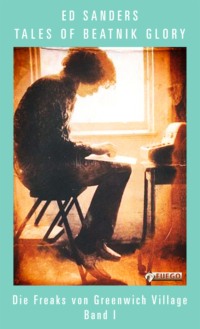Czytaj książkę: «Tales of Beatnik Glory, Band I (Deutsche Edition)»
— DEUTSCHE EDITION —
Ed Sanders
Tales Of Beatnik Glory
Band I
Die Freaks von Greenwich Village
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Pociao
FUEGO
Über dieses Buch
— Band I der vierbändigen Ausgabe —
Kaum jemand hat die neueren kulturellen Strömungen und Umwälzungen in der Kunst, der Musik und vor allem in der Literatur stärker beeinflusst als die amerikanische Nachkriegsgeneration der Beatniks. Namen wie Kerouac, Bukowski, Ginsberg, Burroughs und Sanders sind die Vertreter jener »Wilden Generation«, die in den fünfziger und sechziger Jahren mit ihren literarischen Werken neue Formen des Schreibens, der Kommunikation, des Lebens und der Ansicht unserer Welt dokumentierten und damit bis heute den Rahmen einer kultur- und lebensfeindlichen Umwelt sprengen.
»Die Freaks von Greenwich Village« führt uns in den kulturellen Untergrund der Lower East Side in New York im Wechsel der 1950 zu den 1960er Jahren, wo ein Dichter auf seiner Suche nach Ruhm und Geld zwischen Kakerlaken, Ausgeflippten, Bohemians, Intellektuellen, Klugscheißern und Schizoiden landet. Der Rahmen der Geschichten spannt sich von Dichterlesungen voller Schräg- und Eitelkeit über Antikriegsdemonstrationen und die Weltuntergangsstimmung während der Kubakrise hin zu den chaotischen Redaktionstreffen der literarischen Avantgarde.
»Sanders erzählt mit einer gehörigen Portion Selbstironie, ohne Verbitterung, doch voll satirischem Witz aus den Urzeiten der Alternativ-Szene und die schrägen Vögel an der Lower East Side geben zu anhaltender Heiterkeit Anlass« schreibt Florian Vetsch in der Neuen Zürcher Zeitung.
D en Partisanen der späten Fünfziger und der 1960er und ihrer Vision einer großen gewaltfreien Besserung gewidmet. Ebenso jenen, die in den Bistros waren, in den Cafés, auf den Friedensmärschen, den Freiheitsfahrten, den Sit-Ins, den Kundgebungen gegen die Atombombe, in den Sozialwohnungen, den Parks, den Buchläden, den städtischen und ländlichen Kommunen, die dem Pentagon-Exorzismus beiwohnten, den Mobilisierungen gegen den Krieg, und den Tausenden von Planungstreffen für eine Revolution, gleich denen von 1825, 1848, 1870, 1905, 1934 und 1968. Außerdem jenen Teilnehmern der Primary Color-Revolution und der Hippie/Beatnik-Verbrüderungen gewidmet, wie denen im Avalon Ballroom in San Francisco, dem Fillmore East und West und auf Tausenden von Stroboskoplicht-Meetings von Küste zu Küste. Und ebenso den Partisanen von LeMar, der Druckmatrizen-Revolution, der Untergrundfilm-Bewegung, dem Netzwerk der Untergrundpresse und all jenen, die ihre Seelen ausschütteten in zahllosen Versammlungen und Planungstreffen für ein besseres Amerika, darunter Zehntausende Benefizveranstaltungen, Be-Ins, Love-Ins, Jam Sessions und Flugblätteraktionen.
Vor allen Dingen aber ist dieses Buch jenen Partisanen in aller Welt gewidmet, die erkennen, dass das Thema der Rose, so lebenswichtig für unsere Jugend, wieder aufkommen wird – so wie es dies alle paar Jahrzehnte wieder getan hat – und dass es der Tanz unserer Leben ist, welcher die Rose wachsen lässt.
DIE SCHWIEGERMUTTER
Als sie den schmuddeligen Beatnik heiratete, breitete sich diese Schande wie eine Schlingpflanze über ihren Stammbaum und seine letzten noch lebenden Reste aus. Eine junge Dame aus untadeligem Haus, mit den besten Aussichten auf eine glückliche und gesicherte Partie, die gut aussah, in drei Sprachen bewandert war und auch noch neun Jahre Klavierunterricht hinter sich hatte — und so was ließ sich doch tatsächlich dazu herab, eine nuschelnde, schäbige, Gedichte schreibende Person zu heiraten, über deren Familie man genauso wenig Bescheid wusste wie über ihre Herkunft — Nebraska womöglich. Das versetzte ihren Eltern einen gründlichen Schock — sie waren so fassungslos, dass sie nicht nur Polizei, Rechtsanwälte und Privatdetektive mobilmachten, sondern sogar alle Möglichkeiten für eine legale Einweisung in die Irrenanstalt prüften.
Den Beatdichter kümmerte das alles wenig. Die Eltern bedeuteten ihm nichts weiter als ein paar Kerben mehr am Stecken der Spießer. Er sagte sich: Sie existieren gar nicht. Und wenn sie versuchen, trotzdem zu existieren, dann verschwinde ich mit meinem Engel, ihrer Tochter, irgendwohin, wo sie nicht existieren. Das war die einzige Botschaft, zu der er sich je aufraffen konnte; danach riss die Verbindung zwischen dem Bösewicht und ihren Eltern ab, und er verlegte sich aufs Schweigen.
Aber schon Jahre vor der Hochzeit feuerte die Gegenpartei aus allen Rohren. Die beiden begegneten sich im Spätsommer 1959 in einem Café auf der McDougal Street. Er galt hier mehr oder weniger als Hausballadier und war den ganzen Sommer über voll damit beschäftigt, eine Reihe von sonntagnachmittäglichen Dichterlesungen zu organisieren, zu denen sich die vielversprechendsten Talente der Beat-Ära einfanden.
Als sie sich zum ersten Mal begegneten, sah sie aus wie eine Sein-oder-nicht-sein-Beat-Ballerina. Ihre langen blonden Locken waren zu einem Knoten hochgesteckt, mit einem süßen goldenen Pony, der ihr über die Stirn fiel. Sie hatte schwarze Seidenstrümpfe an und elegante schwarze Stöckelschuhe dazu. Die braune Lederweste mit den Fransen an der Seite war der letzte Schrei auf der Bleecker Street; sie trug sie über einem schwarzen Rollkragenpullover und nichts drunter — für ’59 wirklich der Gipfel an Kühnheit.
Ihre Augen waren eine Mischung aus Nofretete und Juliette Greco: dicke schwarze Tuscheränder und Unmengen von Lidschatten. Nie im Leben wäre jemand auf die Idee gekommen, sie für einen Spießer aus Queens zu halten, dafür würde sie schon sorgen. Schließlich wusste sie ganz genau, wie man auszusehen hatte, wenn man ein echter Villager sein wollte.
Bei dieser ersten mystischen Begegnung hockten sie da und redeten acht Stunden hintereinander, ohne Pause. Dann verabredeten sie sich für den nächsten Tag nach der Schule. Und dann den Nächsten. Und Übernächsten.
Na ja, die Art, wie sie sich anzog, ging ja noch, meinten ihre Eltern. Schließlich wohnte man in New York und nicht in irgendeinem miesen Provinznest. Aber jetzt plötzlich mit diesem Dreckskerl aus Greenwich Village herum, herum, herumzuhängen und weiß Gott was sonst noch mit ihm zu treiben, also das war einfach unmöglich, fanden Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und Vettern aus dem Hinterland von Flushing, New York. Die ganze Familie verbündete sich, um der gerade erblühten Liebe ein Ende zu machen. Sie war siebzehn und wurde in zwei Monaten achtzehn, also mussten sie sich ranhalten.
Sie schrieben Briefe, telefonierten und verschickten Telegramme — an den Beatnik, seine Eltern und die Schule. Sie heuerten Privatdetektive an. Aber alle Drohungen waren vergeblich; die beiden nahmen sie gar nicht erst wahr, sondern ließen sie gleich bis auf den Grund ihres chaotischen Unterbewusstseins sinken. Die Eltern versuchten, sie mit Gewalt in eine andere Schule zu versetzen — die typische Taktik von Eltern, wenn sie mit den Affären ihrer Sprösslinge nicht einverstanden sind. »Fickt euch«, konterte sie, »dann geh ich eben gar nicht mehr zur Schule!«
In den Weihnachtsferien 1959 hauten sie endgültig ab. Zuerst versuchten sie, im Pennerhotel auf der Bleecker Street unterzuschlüpfen, aber da lachte man sie glatt aus. Also verbrachten sie die Nacht in einem Kino am Times Square, wo sie stundenlang das gleiche Programm über sich ergehen ließen: The Blob und I Married a Monster from Outer Space. Am Silvesterabend riefen die Eltern bei der Polizei an und erstatteten Vermisstenanzeige, aber der diensthabende Officer fragte nur, wie alt ihre Tochter denn wäre und ob sie einen Freund hätte. Und weil sie vor Kurzem achtzehn geworden war, war die Sache damit erledigt.
Sie lungerten in der Beatszene herum — halb verhungert, um ehrlich zu sein, — und suchten nach einer möglichst praktischen Lösung. Sie schlenderten durch die Straßen, schmusten am helllichten Tag und verwirklichten mit jeder fiebrigen Faser ihrer Körper Audens berühmte letzte Zeile aus September 1, 1939. Sie verpassten keine Dichterlesung, keine Art Show, keinen neuen Film, kein Ritual perversester Obszönitäten, kurz — kein Ereignis, das auch nur im entferntesten nach Rebellion schmeckte.
Und erst die Buchhandlungen auf der Fourth Avenue! Unzählige Nachmittage verbrachten sie in den rund zwanzig staubigen Läden mit ihren abgenutzten Holzfußböden, und ihre Nasen sogen tief diesen unübertrefflichen Geruch von Buchläden ein — eine Mischung aus Staub und dem schwachen Duft nach antiken Ledereinbänden und brüchiger Leinwand. Und was für ein paradiesisches Wissen lag vor ihnen, wenn sie dort oben auf der wackligen Leiter standen, mit einem drei Meter langen Regal vor sich, das mit lauter vergriffenen Gedichtbänden vollgestopft war.
Ihr größtes Problem war ein Platz zum Ficken. In seine armselige Bruchbude an der Elften Straße konnten sie nicht, denn laut Vermieter dieser Absteige waren Besucher gleich welchen Geschlechts grundsätzlich verboten. Und außerdem schaffte er es sowieso kaum, die Miete plus Nebenkosten plus Stromgeld zusammenzukratzen, um sich eine eigene Bude leisten zu können. Die New Yorker Parks waren ihr Revier. Sie fickten überall. Sie waren die Einzigen, die es je mitten auf der gewölbten kleinen Steinbrücke gebracht hatten, die in der Nähe vom Central Park liegt. Das behauptete jedenfalls der Bulle, der ihre Vereinigung im Licht der Straßenlaterne störte, und zwar grad im äußerst kritischen Moment der totalen Auflösung, als beide kurz vorm Explodieren waren, und sie ihre Ohren nur auf die immer lauter werdenden Schritte Eros eingepeilt hatten und nicht auf ordinäre Gummisohlen.
Sie versuchten es im Stehen, gegen den niedrigen Zaun am Pennerviertel vom Washington Square gelehnt, als der Park schon geschlossen war. Sie fickten auf der Reit-Aschenbahn, die westlich vom Central Park etwa auf der Höhe der Zweiundsiebzigsten Straße liegt, und wurden von Polizeipferden überrascht — wieder mal im ungünstigsten Augenblick. Sie fickten in Sportwagenmanier auf einer Bank in der Zweiundsiebzigsten Straße, diesmal auf der Ostseite des Parks (übrigens in derselben Nacht, direkt nach dem Reitbahn-Reinfall).
Und besonders gern trieben sie’s im Inwood Park. Einmal kraxelten sie in einer Neujahrsnacht weit rauf in die Felsen über dem kleinen See der Columbia University am Nordrand von Inwood. Halb lehnten, halb lagen sie auf einem steilen, vereisten Abhang zwischen riesigen Geröllhalden — als sie plötzlich mitten im Fick ins Rutschen kamen; sie konnten sich nicht mehr halten, rammelten aber feste weiter und verpassten ihrem Ärschchen noch einen Extra-Kick, als sie fünf Meter über eine hauchdünne Eisschicht bergab fegten.
Diese Erfahrung war der absolute Gipfel. Sie verkauften und verpfändeten alles, was sie zwischen die Finger kriegten, schnorrten sich den Rest zusammen und mieteten sich damit ein kleines Nest auf der Ecke Dritte Straße Ost und Avenue B, was den Eltern einen neuen Schrei der Entrüstung entlockte, der aber genauso wenig ausrichtete wie alle anderen.
Als er es wagte, sich für ein Semester von der Schule abzumelden, brachte ihn die geballte Wut ihrer Familie beinah in Schwierigkeiten mit dem FBI. Der Alte kriegte Wind davon und schrieb dem FBI einen Brief, in dem er sich bitter beklagte, dass ein ordinärer Drückeberger, der einer Anzeige wegen Notzucht bloß um lumpige zwei Monate entgangen war, das Gesetz gradezu mit Füßen trete, denn er ginge zwar nicht mehr aufs College, sei aber trotzdem noch immer vom Wehrdienst befreit. Wie konnte das FBI auch nur eine Minute länger zögern, diesen verlausten Kommunistenflegel einzukassieren, tobte der Vater, oder noch besser, warum schaffte man ihn nicht augenblicklich in die nächste Kaserne?
Der Brief erregte beim FBI tatsächlich eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber dem Beatnik. Man schickte eine Abordnung in die Lower-East-Side-Behausung des jungen Paares, das aber glücklicherweise grad nicht zu Hause war.
Zu dieser Zeit waren die Maßnahmen des FBI, wenn sie die gesuchte Person nicht antrafen, reine Routinesache. Sie schoben ihr ein genormtes Formular unter der Türritze durch, auf dem folgender schreckenerregender Text vorgedruckt war. Ganz oben stand der volle und rechtskräftige Name des »Subjekts«, das sie zu belästigen wagten, drunter die Aufforderung: »Setzen Sie sich bitte mit unserem Special Agent Edward Barnes in Verbindung. Federal Bureau of Investigation.« Und dann die Nummer vom FBI mit dem Nebenanschluss von Mr. Barnes.
Der Poet hatte natürlich keine Ahnung von dem Brief, der beim FBI eingegangen war. In seiner Vorstellung spielten sich die grausigsten Visionen von Polizeistaat und Bullenterror ab. Erstmal spülte er seinen gesamten Shitvorrat, der in der Wohnung verteilt war, ins Klo. Sollte das etwa ein gezielter Angriff auf Beatdichter sein? Absurder Gedanke. Aber hatte er nicht neulich seine Unterschrift unter eine Petition gesetzt, die für die Begnadigung von Caryl Chessman eintrat? Vielleicht hatten sie deshalb hier rumgeschnüffelt? Er überlegte hin und her, hörte im Geist schon das Gerassel imaginärer Handschellen und hatte ständig den Soundtrack vom FBI-Radioprogramm im Ohr.
Er rief beim FBI-Büro an und wurde aufgefordert, in einer Kleinigkeit, die seinen Militärdienst anging, an der Siebenundsechzigsten Straße Ost vorzusprechen. Uh-oh. Uh-oh und Terror.
Man verhörte ihn in einem abgelegenen Zimmer, das voller Agenten und Schreibtische steckte. Sie erzählten ihm, dass sie gar nicht scharf drauf wären, ihn zu schnappen, aber sie müssten nun mal einen Bericht machen, weil das vorgeschrieben sei. Er machte ihnen weis, dass er sich nächstes Semester bestimmt in der Schule zurückmelden würde, und tat sein Bestes, um seinen zukünftigen Schwiegervater als exzentrischen Zittergreis hinzustellen.
Wenn der Alte ans FBI geschrieben hatte, überlegten die beiden, dann konnte man wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass er auch die New Yorker Polizei verständigt hatte; kleiner Hinweis auf Drogenmissbrauch womöglich. In den nächsten paar Jahren suchten sie sich für ihr Gras höchst raffinierte Verstecke aus. Beispielsweise benutzten sie die Gras-aus-dem-Fenster-Abseil-Methode mit einer Rasierklinge in der Nähe. Oder auch die Shit-überm-Klo-Baumel-Technik. Es war zwar umständlich, solche Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, aber in diesen Zeiten auch nicht ungewöhnlich. Die beiden kannten einen Burschen, der hatte seinen Hund zum lebenden Grasschlucker abgerichtet, für den Fall, dass die Bullen plötzlich an die Tür klopften. Das Vorhandensein eingebauter Verstecke gehörte wahrend der Beat-Ära zu den wichtigsten Gründen, die für oder wider eine bestimmte Wohnung sprachen, Risse oder Sprünge im Mauerwerk, Vertiefungen usw., aber auch die Überlegung, wie lange im Notfall die Haustür den Drogenschnüfflern standhalten würde.
Die nächste Krise wurde bei ihrer Heirat ausgelöst, als die Familie allen Ernstes erwog, entweder sie oder ihn oder alle beide in die Klapse zu verfrachten. Ein Onkel in der Sippschaft war Arzt. Sie setzten den armen Kerl mit allen Mitteln unter Druck, nur um ihn so weit zu kriegen, dass er den Beatnik einlieferte. »Um Marias willen ...«, schluchzte Mutter am Telefon, und ihre Tränen tropften auf den Hörer. Als Antwort darauf ließ der Beatnik die Botschaft »Nur über unsere Leichen« unter dem Stammbaum explodieren und auf einen Schlag waren die Fronten wieder ruhig.
Die Kinder milderten den Hass der Familie ein bisschen. Der Dichter selbst begnügte sich mit Schreiben und Schweigen. Aber als ihnen der totale Entzug ihrer Enkelkinder drohte, wurden die Eltern langsam weich. Von ihm aus konnten sie alle zum Teufel gehen, dachte sich der Dichter nach all den Jahren harten Kampfes. Wenn sie es wagten, ihm auf den Wecker zu fallen, würde er mal kurz grunzen und die Stirn runzeln, ansonsten aber keinen Ton von sich geben, das schwor er sich. Mit einem naserümpfenden, misstrauischen Beatnik in zerlumpten Klamotten musste übrigens so manche Mittelstandsmutti fertig werden, wenn sie sich in die Slums vorwagte, um einen Blick auf ihre Enkel zu werfen.
So vergingen die Jahre der Armut in glücklicher Eintracht mit Kakerlaken, Ratten und haufenweise Abfall. Manchmal ging es ihnen so dreckig, dass sie T-Shirts zu Windeln umfunktionieren mussten, weil sie sich keine Pampers mehr leisten konnten. Einmal rissen sie sogar einem National-Book-Award-Poeten, der grad bei ihnen zu Besuch war, das Hemd vom Leib und machten eine Windel draus. Und das nur ein paar Tage nach seiner Preisverleihung.
Gelegentlich suchten sie alle ihre Gedicht- und Romanerstausgaben zusammen und verscherbelten sie an Antiquariate. Ständig baten sie Schriftsteller, ihnen ihre Bücher zu signieren. Auf Dichterlesungen im Y auf der Zweiundneunzigsten Straße hingen sie gewöhnlich back stage bei den Dichtern rum und kassierten ihre Autogramme ab. Eine signierte Erstausgabe, oh Mann, das war was!
In einem Anfall von schierer Verzweiflung stellte er sich auch manchmal in die wartende Menschenschlange vor der Blutbank auf der Third Avenue und ließ sich für zehn Dollar einen halben Liter aus dem Arm zapfen. Zehn Dollar, das machte: $ 1.98 für Pampers, siebzig Cent für vier Päckchen Spaghetti, fünfunddreißig Cent für eine Schachtel Spinatnudeln, ein Pfund Hüttenkäse neunundsechzig Cent, Zucker, Kartoffeln, vier Liter Milch, Eier und drei Marshmallows aus dem Supermarkt, zwei Dosen Bier, eine Cola — und alles, was dann noch übrig blieb, waren lumpige drei Dollar. Aber dafür war auch morgen ein besonderer Tag, einer mit besseren Aussichten — mit stundenlangem Studium vervielfältigter hochverräterischer Schriften und tiefgründigen Diskussionen im Tompkins Square Park, vier ausgeprägten Halluzinationen, zahllosen Spaziergängen in Richtung Fourth Avenue und ihren Buchläden, aber vor allem ein Tag der F r e i h e i t.
Im Laufe der Jahre tauchte dann allmählich das Phänomen der Plastiktüte auf. Wenn die Schwiegermutter bei ihren gelegentlichen, hastigen Samstag- oder Sonntagnachmittagsbesuchen in der verdreckten Feindeswohnung auftauchte, schleppte sie meistens Plastiktüten von beachtlicher Größe an. Oft brachte sie sogar Sachen aus ihrer eigenen Speisekammer mit, so verrücktes »Zigeuner«-Zeug, wie verschmähte Dosen mit Palmenherzen, Streit’s schokoladenüberzogene Matzen, eingelegte Melonen in Stücken oder kleine Schachteln Kasha. Die Plastiktüten enthielten aber auch stapelweise Windeln, Milch oder Zucker. Offenbar schmiss die Schwiegermutter nie irgendwas weg. Ihre besonderen Reißer waren Babysachen für die Enkelkinder, die schon deren Mutter, ihre Tochter, in diesem Alter getragen hatte. Das Gleiche galt für Spielzeug und Puppen, mit denen die Mutter vor zwanzig Jahren gespielt hatte. Ab und zu kam es vor, dass Schwiegermutter mitten in eine politische Versammlung platzte, in die Organisation einer Demonstration zum Beispiel mit Amerikas berüchtigtsten Radikalen, jungen Männern und Frauen, für die die Regierung Millionen von Dollar zum Fenster rauswarf, nur um sie zu bespitzeln, zu belästigen, zu verhören und ihnen nachzuschnüffeln. Sie alle rückten schweigend auseinander, wenn Großmutter mit ihren Bündeln von Zeugs durchs Zimmer stampfte. Der Schwiegervater hielt es am längsten aus und blieb in seinem Hass auf den »dickköpfigen Beatnik-Fatzke« lange unversöhnlich. Einmal spritzte er sogar heimlich grüne Pflanzenfarbe in eine frische Milchtüte, die dann bei einem der typischen Plastiktütensonntagsnachmittagsbesuche in den Saustall geschmuggelt wurde. Sie machten die Tüte erst später auf. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als sich ein Glas frische Milch einzugießen und plötzlich faulig grüne Schlieren vom Mars aus der Öffnung sickern zu sehen. Aber allmählich wurde sogar der Alte ruhiger und fand sich mit der Ehe ab.
Absolut nichts konnte die Schwiegermutter abhalten — kein Schuppen und kein geodätischer Sommerdom irgendwo draußen im Wald, keine Mietskaserne voller Junkies war ihr abwegig genug, dass sie nicht mit ihren fünfunddreißig Pfund Obst, Gemüse, Klamotten, Schreibpapier, Vitaminen und Zeitschriften angewalzt kam, und es war ihr ganz egal, wie viele Treppen hoch sie ihren Krempel schleppen musste, den sie in zwei oder drei Care-Paketen verstaut hatte — wie sie von den beiden spaßeshalber genannt wurden.
Im Sommer 1964 verbrachten sie mit ihren Kindern ein paar Monate in den Catskill-Wäldern, abseits von einer Holzfällerschneise bei Phoenicia, New York. Sie hausten in einem alten gestreiften Partyzelt, das aus einem Long-Island-Nachlass stammte. Darüber im ersten Stock befanden sich ihre Schlafquartiere — ein Baumhaus, das nach allen Seiten offen war, dafür aber ein Dach aus Plastik hatte. Mehrere Wochen lebten sie in glücklicher Abgeschiedenheit vor sich hin, bis sie eines schönen Sonntagnachmittags — Stampf! Stampf! Stampf! — Schritte hörten, die sich durch trockenes Gestrüpp und Unterholz kämpften. Mit Protein und Energie beladen näherte sich ihrem Zelt die Schwiegermutter.
Sie waren nicht überrascht, im Laufe der Jahre zu entdecken, dass bei den Bohemiens das Phänomen der Schwiegermutter als Demeter weit verbreitet war. Überall, wo sich Künstler und Schriftsteller in ihrem Existenzkampf zusammentaten, tauchte sie auf. Ewiges Heil der Schwiegermutter!