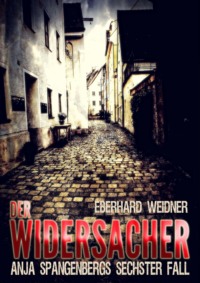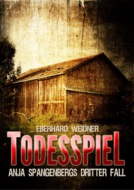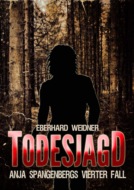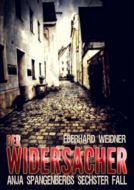Czytaj książkę: «DER WIDERSACHER»

INHALTSVERZEICHNIS
COVER
TITEL
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
ERSTER TEIL: DER LEBENDE TOTE
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
ZWEITER TEIL: DER GOURMET
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
DRITTER TEIL: DER TOD
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
VIERTEL TEIL: DER WIDERSACHER
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
EPILOG
Kapitel 28
NACHWORT
WEITERE TITEL DES AUTORS
LESEPROBE
Prolog: Die Kälte des Todes!
MITTWOCH
Kapitel 1: »Dafür sind Nachbarn doch da.«
PROLOG
Kapitel 1
Sobald sie in der Tiefgarage war, überkam Doris Sonntag stets ein überwältigendes Gefühl der Angst. Auch an diesem Abend war das nicht anders, obwohl die Garage des Hauses, in dem sie und ihr Mann eine Eigentumswohnung besaßen, hell ausgeleuchtet und überschaubar war. Bereits vor neun Jahren, kurz nach ihrem Einzug, hatte Doris auf der Eigentümerversammlung den Antrag gestellt, anstatt der trüben Funzeln hellere Lampen zu installieren. Der Antrag war von den anderen Wohnungseigentümern unterstützt und daher vom Hausverwalter umgehend in die Tat umgesetzt worden. Doch auch die bessere Beleuchtung half nichts gegen die tiefsitzende Angst, die sie jedes Mal empfand, sobald sie aus dem Aufzug trat oder mit dem Wagen in die Tiefgarage fuhr.
Dabei wusste sie als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ganz genau, dass ihre Ängste irrational oder zumindest deutlich übertrieben waren, da sie auf keiner realen Gefahr oder Bedrohung beruhten. Sie hatte auch noch nie ein traumatisches Erlebnis in einer Tiefgarage gehabt, das derartige Ängste nachvollziehbar erscheinen lassen würde. Doch trotz ihres Fachwissens konnte sie sich nicht davon befreien, sondern musste sich ihnen fünf Tage in der Woche mindestens zweimal täglich stellen. Immerhin hatte sie in der Nähe ihrer Praxis einen oberirdischen Stellplatz anmieten können, sodass sie dort nicht an jedem Arbeitstag haargenau in dieselbe Situation geriet.
Als sie nun ihren Wagen, einen obsidianschwarzen Mercedes CLS 350 Coupé, langsam durch die Tiefgarage lenkte, sah sie sich nervös in alle Richtungen um. Sie verrenkte sogar den Kopf, um in die hintersten Ecken sehen zu können. Gleichzeitig musste sie heftig schlucken, um den vermeintlichen Kloß zu entfernen, der in ihrem Hals steckte und ihr die Atmung erschwerte. Diese war ebenso wie ihr Herzschlag unwillkürlich schneller geworden, sobald sie den Wagen durch das geöffnete Tor auf die abwärts führende Rampe gefahren hatte.
Doris hatte erst vor wenigen Tagen ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert. Sie war ein Meter sechsundsechzig groß, hatte eine knabenhaft schlanke Statur, kurze mittelbraune Haare und braune ausdrucksstarke Augen, bei denen ihre Patienten unwillkürlich das Gefühl hatten, sie könnte damit bis in die verborgensten Tiefen ihres Innersten blicken. Sie war heute etwas später als sonst dran, weil sie auf dem Heimweg von der Praxis noch am Supermarkt haltgemacht hatte. Normalerweise kauften sie und ihr Mann, der als Chirurg in einer Privatklinik für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie tätig war, samstags für die gesamte Woche ein. Doch vor einer Stunde hatte ihr Mann Dietmar angerufen und ihr mitgeteilt, dass er überraschend einen alten Studienfreund getroffen und heute Abend zum Essen eingeladen hatte. Doris konnte es nicht ausstehen, wenn ihr straffer, meistens minutiös durchgeplanter Tagesablauf durcheinandergewirbelt wurde, doch Dietmar schaffte es immer wieder, dass sie seinem sprunghaften Verhalten und seinen spontanen Einfällen nachgab und ihm nicht lange böse sein konnte. Deshalb hatte sie rasch alle Zutaten für eine Tomatensuppe als Vorspeise, einen gemischten Salat und provenzalisches Hähnchen mit Grillgemüse eingekauft. Sie war zwar, wie sie sich selbst gegenüber eingestehen musste, keine besonders gute Köchin, doch da sie die ausgewählten Gerichte inzwischen oft genug zubereitet hatte, würde es keine unliebsamen Überraschungen geben.
Als sie sich nun dem Doppelstellplatz näherte, der zu ihrer Wohnung gehörte, war Doris überzeugt, dass sich außer ihr niemand in der Tiefgarage aufhielt. Allerdings beruhigte sie dieser Gedanke nicht, da die irrationale Furcht, jemand könnte ihr an diesem Ort auflauern, sich von rationalen Überlegungen nicht im Mindesten beeindrucken ließ. Im Gegenteil, ihre Angst intensivierte sich sogar noch, denn solange sie im Wagen saß und die Türen verriegelt waren, fühlte sie sich noch verhältnismäßig sicher. Sobald sie allerdings geparkt hätte, würde sie den Wagen verlassen müssen, um ihre Einkäufe aus dem Kofferraum zu nehmen und zum Aufzug zu gehen. Zum Glück lagen ihre Stellplätze nicht weit davon entfernt, sodass sie nur wenige Meter zurücklegen musste. Für sie war es dennoch der nervenaufreibendste und gefühlt gefährlichste Teil ihres Weges in die Sicherheit, die die Fahrstuhlkabine ihr versprach.
Da das Einparken aufgrund der Pfeiler ein hohes Maß an Konzentration erforderte, war ihr eine kleine Atempause vergönnt, in der sie nicht so stark von ihren Ängsten geplagt wurde. Doch sobald das Auto stand und sie sich davon überzeugt hatte, dass sie rechts genug Platz für Dietmars Jaguar gelassen hatte, kehrte die Furcht in unverminderter Stärke zurück.
Doris stellte den Automatikhebel auf P, zog die Feststellbremse an und schaltete dann den Motor aus. Sobald das Motorbrummen verstummt war, verhielt sie sich eine Weile mucksmäuschenstill, hielt sogar den Atem an und lauschte aufmerksam. Doch über das rasche Klopfen ihres Herzens hinaus war nur das Knacken abkühlender Metallteile des erhitzten Motorblocks zu hören. Sie sah sich mit ruckartigen Bewegungen um, wobei sie wie ein aufgeregter Vogel wirkte, konnte jedoch nichts Verdächtiges entdecken.
Niemand da!
Sobald sie zu diesem Schluss gekommen war, hatte sie es eilig, den Wagen zu verlassen, denn sie wollte in der Aufzugskabine sein, bevor die Zeitschaltuhr dafür sorgte, dass das Licht in der Tiefgarage ausging. Erschaudernd erinnerte sie sich daran, wie sie einmal zu lange im Wagen sitzen geblieben war, weil sie zu ängstlich gewesen war, um auszusteigen. Auf dem Weg zum Fahrstuhl war es dann plötzlich dunkel geworden. Nur die Notbeleuchtung hatte gebrannt. Doris hatte geglaubt, sie würde an Ort und Stelle sterben, weil ihr Herz jäh zu schlagen aufgehört und sich geweigert hatte, seinen Dienst sofort wieder aufzunehmen. Doch dann hatte der Herzschlag zum Glück wieder eingesetzt, heftiger als je zuvor, und sie war wimmernd zum Fahrstuhl gerannt und hatte den erleuchteten Lichtschalter daneben betätigt, worauf es endlich wieder hell geworden war. Der furchtbare Vorfall hatte sie einige graue Haare und mit Sicherheit ein paar Jahre ihres Lebens gekostet. Damit er sich nicht wiederholte, hatte sie den Hausmeister gebeten, den Zeittakt der Tiefgaragenbeleuchtung zu verlängern. Es waren wahrscheinlich weniger ihre Worte, sondern eher der Hunderteuroschein gewesen, der den Mann schließlich davon überzeugt hatte, ihren Wunsch zu erfüllen, doch das war ihr egal, denn am Ende zählte nur das Ergebnis. Seitdem war sie nicht mehr von der Dunkelheit überrascht worden. Dennoch wusste sie, dass sie nicht trödeln durfte und sich beeilen musste.
Sobald sie sich ihre Handtasche geschnappt hatte und eilig ausgestiegen war, wurde das Angstgefühl in ihr intensiver und schnürte ihr die Kehle zu, sodass sie Schwierigkeiten hatte, genügend Luft zu bekommen. Der rationale Teil ihres Verstandes, der weiterhin in der Lage war, ihr zutiefst irrationales Verhalten zu analysieren, erklärte ihr im Tonfall eines gelangweilten Hochschulprofessors, dass die Angst zur Alarmreaktion ihres Körpers und damit zur Aktivierung verschiedener Körperfunktionen führte. Indem ihr Herz schneller schlug, ihre Atmung rascher erfolgte, die Muskeln sich am ganzen Körper anspannten und gleichzeitig sämtliche Sinnesorgane mit erhöhter Aufmerksamkeit reagierten, wurde sie in die Lage versetzt, rascher und effizienter auf eine mögliche Gefahr oder Bedrohung zu reagieren. Entweder indem sie sich der Gefahr durch Flucht entzog oder dieser in einem Kampf begegnete. Doch da nicht wirklich eine Gefahr drohte und die Angst daher irrational war, waren die Reaktionen ihres Körpers wie das Herzrasen, die Schwindelgefühle, die leichte Übelkeit und die Atemnot in diesem Fall wenig hilfreich und daher eher eine Belastung für sie.
Und obwohl sie sich ihrer Angststörung an jedem Arbeitstag morgens und abends aussetzen musste, war kein Gewöhnungseffekt eingetreten und war es ihr auch nicht gelungen, sie in den Griff zu bekommen. Aber immerhin schaffte sie es aufgrund ihrer nahezu täglichen Routine inzwischen, ein wenig besser damit umzugehen und angemessener darauf zu reagieren.
Doris wusste aus Erfahrung, dass sie die körperlichen Auswirkungen ihrer Angststörung für kurze Zeit komplett ignorieren konnte, indem sie sich stattdessen intensiv auf andere Dinge konzentrierte. Deshalb ging sie nun in Gedanken noch einmal die Zutatenliste für das Essen durch, das sie zubereiten wollte, sobald sie in ihrer Wohnung war und sich frischgemacht und andere Sachen angezogen hatte. Anschließend vergegenwärtigte sie sich in allen Einzelheiten geradezu bildhaft die jeweiligen Arbeitsschritte.
Während sie das tat, eilte sie zum Kofferraum ihres Wagens und entnahm ihm rasch die beiden Tüten mit den Einkäufen. Anschließend schloss sie den Kofferraum und verriegelte das Fahrzeug trotz ihrer Eile gewissenhaft, bevor sie sich schließlich in Bewegung setzte und zum Fahrstuhl lief, so schnell ihre Last es ihr erlaubte.
Das Geräusch ihrer eiligen Schritte wurde von den kahlen Betonwänden zurückgeworfen und verstärkt, sodass sie ihr überlaut vorkamen. Denn auch wenn sie sich gedanklich anderweitig beschäftigte, lauschte Doris weiterhin auf verdächtige Laute in ihrer Umgebung und sah sich wie ein hypernervöses Beutetier ständig um.
Erst als sie ohne Zwischenfall den Fahrstuhl erreicht und auf den Knopf gedrückt hatte, wagte sie es zum ersten Mal, erleichtert aufzuatmen. Es war ihr zwar von vornherein klar gewesen, dass ihr – wie unzählige Male zuvor – in der Tiefgarage keine reale Gefahr drohte, dennoch war sie heilfroh, dass sie wieder einmal recht behalten hatte.
Die Fahrstuhlkabine war in einem der oberen Stockwerke gewesen. Doris hörte, wie sie sich von dort aus in Bewegung setzte und nach unten fuhr. Sie wandte der Fahrstuhltür den Rücken zu, um die Tiefgarage weiterhin im Auge behalten zu können. Doch nun, da sie alsbald die Garage verlassen konnte und damit in Sicherheit war, legten sich sowohl ihre Angst als auch die physiologischen Reaktionen allmählich, die diese ausgelöst hatte. Doris erlaubte sich sogar ein angedeutetes Lächeln, als ihr bewusst wurde, dass sie es wieder einmal überstanden und gleichzeitig ihrer größten irrationalen Angst getrotzt hatte, ohne sich ihr zu unterwerfen. Schließlich könnte sie es sich auch einfach machen, indem sie Situationen, die diese Angst in ihr auslösten, komplett vermied und sich schlicht und einfach weigerte, die Tiefgarage auch nur zu betreten. Es war zwar schwierig, in dieser Gegend einen oberirdischen Parkplatz zu finden, aber nicht völlig unmöglich. Doch Doris betrachtete es als Therapie, sich ihrer Angst zu stellen, auch wenn diese Therapie in ihrem Fall bislang kaum angeschlagen hatte.
Erst als die Fahrstuhlkabine im Schacht hinter ihr ruckelnd zum Stillstand kam und sich die Tür öffnete, wandte sie sich um. Sie wollte den Aufzug rasch betreten und unverzüglich den Schalter für ihr Stockwerk drücken. Wenn sich die Tür dann endlich schloss, wäre sie endgültig in Sicherheit und könnte damit beginnen, sich zu entspannen.
Doch noch ehe Doris sich in Bewegung setzen konnte, trat jemand aus der Kabine und ihr entgegen.
Doris stieß vor Schreck einen Schrei aus. Sie ließ die beiden Tüten mit ihren Einkäufen sowie ihre Handtasche fallen. Dann fasste sie sich mit beiden Händen an die Brust, weil sie befürchtete, diesmal den tödlichen Herzinfarkt zu bekommen, mit dem sie schon damals gerechnet hatte, als das Licht ausgegangen war. Gleichzeitig schalt sie sich selbst für ihre Dummheit, denn zweifellos war es nur einer der anderen Hausbewohner, der zu seinem Wagen wollte und über die unerwartete Begegnung nun ebenso erschrocken wie sie war.
Die Einkaufstüten prallten mit einem dumpfen Laut rechts und links von ihr auf den Boden. Etwas Gläsernes in ihrem Innern zerbrach mit einem lauten Klirren, worüber Doris sich trotz ihres Schrecks unwillkürlich ärgerte.
Doch ihr Ärger verflog augenblicklich, als ihr Blick auf ihr Gegenüber fiel. Erstens erkannte sie in ihm keinen der anderen Hausbewohner wieder, die sie fast alle persönlich kannte, wenn auch nur von kurzen Begegnungen im Treppenhaus oder von den jährlichen Eigentümerversammlungen. Zweitens machte er keinen erschrockenen, sondern einen eher zielgerichteten Eindruck. Und drittens sah er darüber hinaus auch noch extrem merkwürdig aus.
Er war groß und überragte sie um mehr als einen ganzen Kopf, wirkte aber noch deutlich größer, weil er beinahe skelettartig dünn war. Der Eindruck eines lebenden Toten, den er bei seinen Mitmenschen unwillkürlich erwecken musste, wurde durch den Rest seiner Erscheinung noch verstärkt. So hatte er unter anderem das fahle Äußere eines blutleeren Leichnams und extrem kurz geschnittenes weißblondes, fast durchscheinend wirkendes Haar, durch das seine geäderte Kopfhaut zu sehen war. Seine grauen, leblos erscheinenden Augen lagen tief in den dunkel umrandeten Höhlen seines an einen Totenschädel erinnernden Kopfes. Darüber hinaus verströmte er einen unangenehmen Geruch, der sie unwillkürlich an Beerdigungen denken ließ. Er war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, was seine Gesichtshaut noch bleicher wirken ließ, und trug schwarze enganliegende Lederhandschuhe.
In dem kurzen Augenblick, den Doris benötigt hatte, um all diese Einzelheiten in sich aufzunehmen, hatte der unheimliche Mann sie bereits erreicht. Und bevor sie in irgendeiner Form darauf reagieren konnte, prallte er gegen sie und stieß sie mit beiden Händen kräftig zu Boden. Sie schrie ein weiteres Mal, doch der Schrei endete wie abgeschnitten, als ihr Hinterkopf heftig und schmerzhaft auf den Betonboden prallte, sodass sie für einen kurzen Moment das Bewusstsein verlor. Sie erlangte es zwar sofort wieder, war jedoch leicht benommen und stöhnte leise.
Der Angreifer gönnte ihr allerdings keine Atempause. Er setzte sich rittlings auf ihren Brustkorb, sodass er mit den Unterschenkeln ihre Arme gegen den Boden pressen konnte.
Als die Benommenheit endlich wich und Doris realisierte, dass ihre irrationale Angst plötzlich Wirklichkeit geworden war, begann sie, sich panisch zur Wehr zu setzen. Ihre eingeklemmten Arme waren nutzlos, deshalb wand sie sich wie eine Schlange, um den Mann abzuwerfen. Doch obwohl er erschreckend mager war und nur wenig mehr als sie wiegen mochte, lastete er wie ein Tonnengewicht auf ihr und drückte ihren Körper und ihre Arme zu Boden. Sie hob daher die Beine und trommelte mit den Knien gegen seinen Rücken. Doch das schien ihn ebenfalls nicht besonders zu beeindrucken; er verzog lediglich das Gesicht zur Grimasse eines Totenkopfgrinsens und lachte meckernd.
Aufgrund der Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen änderte Doris daraufhin ihre Taktik. Sie riss den Mund weit auf und schrie so laut, wie sie es noch nie in ihrem Leben getan hatte und hoffentlich auch nie wieder tun musste. Womöglich war einer der anderen Hausbewohner zufällig in der Nähe, hörte ihren Schrei und kam ihr zu Hilfe.
Doch der skelettartige Mann legte ihr blitzschnell die linke Hand auf dem Mund und drückte mit dem Daumen ihren Unterkiefer nach oben, sodass ihr Schrei augenblicklich erstickt wurde und sie ihn nicht beißen konnte. Auch wenn er überhaupt nicht danach aussah, schien er erstaunlich kräftig zu sein, denn obwohl Doris erbittert dagegen ankämpfte, war sie gezwungen, den Mund zu schließen, bis ihre Lippen so fest aufeinandergepresst wurden, dass es schmerzte.
»Spar dir deinen Atem«, sagte der Mann in einem leisen Flüstern, sodass Doris sich anstrengen musste, um ihn überhaupt zu verstehen. Dann beugte er sich nach vorn und sah sie mit seinen Leichenaugen eindringlich an. »Schließlich brauche ich ihn noch.«
Obwohl es weder der rechte Ort noch die richtige Zeit dafür war, dachte Doris automatisch über seine rätselhaften Worte nach. Was meint er damit?, fragte sie sich. Worauf unvermittelt die viel bedeutsamere Frage folgte: Und was hat er mit mir vor?
Sie dachte zunächst an einen Raubüberfall. Immerhin befanden sie sich hier in einem Gebäude mit großzügigen und exklusiven Eigentumswohnungen, in denen vorwiegend wohlhabende Leute wohnten. Außerdem ließ das Äußere des Mannes vermuten, dass er möglicherweise drogenabhängig war und dringend Geld für seinen nächsten Schuss benötigte. Allerdings machte er auf sie überhaupt nicht den Eindruck eines Junkies. Also vermutlich doch kein Raubüberfall.
Aber was dann?
Der zweite Gedanke, den sie zunächst verdrängt, der ihr nun aber immer wahrscheinlicher vorkam, war erschreckender: Er will mich vergewaltigen!
Doris schüttelte den Kopf, so gut es die Hand auf ihrem Mund zuließ, während ihr Tränen in die Augen traten und ihre Sicht verschleierten.
»Hab keine Angst«, flüsterte er, als könnte er ihre Gedanken lesen. »Alles, was ich von dir will, ist deine Atemluft.«
Obwohl Doris fürchterliche Angst hatte, runzelte sie ob der Worte des Mannes verwirrt die Stirn, während die Psychiaterin in ihr versuchte, einen Sinn darin zu erkennen und gleichzeitig eine Diagnose zu stellen.
Was stimmt mit dem Kerl nicht?
Erneut kam es ihr so vor, als hätte der skelettartige Mann ihre Gedanken gelesen. Aber vermutlich konnte er ihr die Verwirrung an den Augen ablesen oder ihre Körpersprache richtig deuten.
»Ich bin tot und verwese allmählich«, hauchte er und nickte dann nachdrücklich, als hätte sie ihm widersprochen. »Und um die Verwesung meines Körpers aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen, benötige ich deine Atemluft.«
Trotz ihrer Angst war Doris in der Lage, sofort eine Diagnose zu stellen. Der Mann litt vermutlich am sogenannten Cotard-Syndrom. Bei diesem Wahn, der im englischen Sprachraum auch Walking Corpse Syndrome genannt wird, ist die betroffene Person davon überzeugt, sie sei tot, existiere nicht, verwese oder habe ihr Blut und ihre inneren Organe verloren. Das Cotard-Syndrom, benannt nach dem französischen Neurologen Jules Cotard, der es als Erster beschrieb, ist häufig eine Folge schwerer Hirnerkrankungen.
Der Verstand der Psychiaterin lieferte ihr wie ein zuverlässiger Computer weitere Daten zum geschichtlichen Hintergrund, zur Symptomatik, zur Pathophysiologie und zur Behandlung dieses Krankheitsbildes. Allerdings zeigte er ihr keine Möglichkeit, wie ihr dieses Wissen in ihrem gegenwärtigen Zustand helfen sollte. Das frustrierte sie, sodass sie all das theoretische Wissen kurzerhand verwarf und ihre Überlegungen stattdessen darauf konzentrierte, was sie tun sollte.
Der Wunsch des Mannes nach ihrer Atemluft erschien ihr eher harmlos. Anscheinend glaubte er in seinem Wahn, er könnte damit die Verwesung seines Körpers aufhalten, von der er überzeugt zu sein schien. Wenn dieser durchgeknallte Irre – als Frau vom Fach vermied Doris eigentlich derartiges Vokabular, doch in der gegenwärtigen Situation scherte sie sich nicht darum – also unbedingt ihre Atemluft wollte, dann konnte er sie gerne haben. Hinterher würde sie sich einfach den Mund abwaschen und gründlich mit einem Mundhöhlenantiseptikum ausspülen.
Um ihm zu signalisieren, dass sie ihm ihren Atem geben wollte, nickte Doris zustimmend.
Sofort verzog er das Gesicht wieder zu seinem unangenehmen Totenkopfgrinsen, das sie erneut erschaudern ließ. »Ich wusste, dass du vernünftig bist«, flüsterte er. »Schließlich bist du Psychiaterin, und mit denen kenne ich mich aus.«
Seine Worte überraschten sie nicht, denn bei seiner Erkrankung musste er eine entsprechende Vorgeschichte und bereits Erfahrungen mit Psychologen und Psychiatern gemacht haben, doch dieses Wissen war im Moment zweitrangig. Wichtig war, dass sie das Beste aus dieser Situation machte und unversehrt davonkam. Sobald er erst einmal seine Hand von ihrem Mund genommen hätte, könnte sie mit ihm reden. Schließlich war das ihr Job, und sie war ausgebildet worden, mit psychisch gestörten Menschen wie ihm umzugehen.
Doch er nahm die Hand nicht von ihrem Mund. Stattdessen griff er mit der anderen Hand unter die leichte Windjacke, die er trug.
Doris schielte ängstlich dorthin, wo seine Hand verschwunden war. Eisiges Entsetzen durchfuhr sie, als die Hand mit einem Messer wieder zum Vorschein kam. Es besaß eine schmale, beidseitig geschliffene Klinge und sah wie ein Brieföffner aus. Doris wollte wieder schreien, doch da seine linke Hand unverrückbar auf ihrem Gesicht lag und ihren Mund verschloss, wurde daraus nur ein unterdrücktes Wimmern.
»Pssssst!«, machte der Mann tadelnd und schüttelte den Kopf. »Wehr dich nicht dagegen, denn ich würde dir ungern mehr als unbedingt nötig wehtun.« Anschließend setzte er die Klingenspitze in der Höhe ihres Herzens unter ihre linke Brust und übte ein klein wenig Druck aus, sodass die Klinge sowohl ihre Kleidung als auch die obersten Hautschichten durchstieß.
In diesem Moment gingen die Deckenlampen in der Tiefgarage aus. Doch aus dem Fahrstuhl, dessen Tür der Mann blockiert haben musste, sodass sie noch immer offenstand, fiel weiterhin Licht auf die beiden Menschen.
Doris stöhnte vor Schmerzen und sog durch die Nase Luft ein, denn mehr war ihr nicht möglich. Sie versuchte, den Kopf herumzuwerfen, um die Hand auf ihrem Mund loszuwerden, doch der Mann ließ sie nicht los. Erneut wollte sie sich aufbäumen und ihn abwerfen, aber auch das ließ er nicht zu.
Er verstärkte den Druck auf das Messer, dessen Klinge langsam, aber unerbittlich tiefer in ihren Körper eindrang.
Der Schmerz durchfuhr ihren Körper wie ein Blitzstrahl. Es fühlte sich an, als würde sie von einem weißglühenden Eisendorn durchbohrt werden. Doris atmete keuchend und stoßweise durch die Nase.
Der Mann beugte sich noch weiter herunter, bis sein Totenschädelgesicht, auf dem ein erwartungsvolles Lächeln lag, unmittelbar über dem ihren schwebte. Dann nahm er rasch die Hand vor ihrem Gesicht, hielt ihr stattdessen mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu, öffnete den Mund ganz weit und presste schließlich seine Lippen auf ihre.
Doris hielt unwillkürlich die Luft an.
Das schien ihm nicht zu gefallen, denn augenblicklich schob er die Messerklinge ein gutes Stück weiter in sie hinein.
Vor Schmerz stieß sie die angehaltene Luft aus, die er daraufhin gierig in sich einsog.
Er nahm seinen Mund von ihrem und sagte: »Atme!«
Doris blieb nichts anderes übrig, als nach Luft zu schnappen. Kaum hatte sie das getan, presste er seinen Mund wieder auf ihren und schob das Messer erneut tiefer in ihren Körper, sodass sie gezwungen war, auszuatmen.
Der Schmerz in ihrer Brust wurde immer stärker, je tiefer sich die Klinge hineinbohrte, sodass sie sich nur noch darauf konzentrieren konnte und kaum etwas anderes wahrnahm. Deshalb bekam sie nicht mit, wie oft ihr Angreifer seine Aktion wiederholte und die Luft inhalierte, die sie ausatmete.
»Gleich ist es vorbei«, sagte er, wie ihr schien, nach einer Ewigkeit flüsternd.
Doris hätte daraufhin Todesangst empfinden müssen, doch über diesen Punkt war sie längst hinaus. Alles, was sie fühlte, war grenzenlose Erleichterung, dass die Qualen endlich ein Ende haben würden.
Schließlich explodierte der Schmerz in ihrer Brust, als er das Messer bis zum Heft hineindrückte und ihr Herz durchbohrte, und überrollte ihren Verstand wie eine lodernde Feuersbrunst.
Gierig inhalierte er ihren letzten Atemzug, bis ihre Atmung schließlich versiegte, hob den Kopf und blickte in ihre brechenden Augen.
»Ich danke dir.«
Sein Flüstern war das Letzte, was sie in dieser Welt wahrnahm. Es begleitete sie, tausendfach widerhallend, als ihr Bewusstsein in den Abgrund jenseits des Todes stürzte.
Sobald die Frau tot war, richtete sich der skelettartige Mann auf und kam auf die Beine. Er trat einen Schritt zurück und sah sich um. Während er die letzten Atemzüge seines Opfers inhaliert, sie gleichzeitig getötet und dadurch gewissermaßen ihr Leben eingeatmet hatte, war es ihm nicht möglich gewesen, auf seine Umgebung zu achten. In diesen ekstatischen Momenten war daher die Gefahr am größten, dass jemand zufällig des Weges kam und ihn auf frischer Tat überraschte. Doch er und der Leichnam der Psychiaterin waren noch immer allein in der dunklen Tiefgarage.
Erneut warf er einen Blick auf sein Opfer, das im Licht, das aus dem Fahrstuhl nach draußen fiel, so aussah, als schliefe es nur. Er war der Frau zutiefst dankbar, dass sie ihm ihre letzten Atemzüge geschenkt und sein Leben für ihn gegeben hatte, auch wenn sie es natürlich nicht freiwillig getan hatte. Doch er spürte bereits, wie es wirkte, denn er fühlte sich kraftvoller und energiegeladener als zuvor. Und der Geruch der Verwesung, der ihn seit seinem Tod umgab und in der Regel sein ständiger Begleiter war, war nicht mehr wahrnehmbar. Allerdings würde die Wirkung nicht allzu lange anhalten und den Zerfall seines toten Körpers letztendlich nur hinauszögern.
Jäh besann er sich darauf, wo er war und dass noch immer die akute Gefahr bestand, dass jemand kam und ihn am Tatort ertappte. Deshalb riss er schließlich den Blick von seinem Opfer los.
Er sah den Schweizer Dolch in seiner Hand an, an dem noch immer das Blut der Frau klebte. Rasch bückte er sich und wischte die Klinge aus Torsionsdamast an ihrem Blazer sauber. Anschließend steckte er den Dolch zurück in die Scheide, die er verborgen unter seiner Jacke trug, und holte stattdessen einen transparenten Tiefkühlbeutel heraus. Dieser enthielt einen einzigen Gegenstand, den er behutsam entnahm und unmittelbar neben der Stichwunde, die inzwischen zu bluten aufgehört hatte, auf dem Leichnam deponierte. Anschließend wandte er sich ab und trat in den Aufzug. Er beseitigte die Türblockade und drückte den Knopf fürs Erdgeschoss. Ihm war noch ein allerletzter kurzer Blick auf sein jüngstes Opfer vergönnt, bevor sich die Tür schloss und der Fahrstuhl mit einem leichten Ruck in Bewegung setzte.