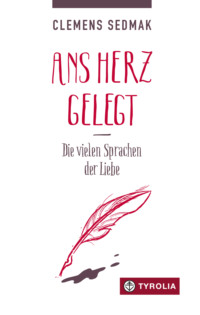Czytaj książkę: «Ans Herz gelegt»
CLEMENS SEDMAK
ANS HERZ
GELEGT
Die vielen Sprachen
der Liebe
TYROLIA-VERLAG • INNSBRUCK-WIEN
Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“
© 2016 Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck
Umschlaggestaltung: stadthaus 38, Innsbruck
Layout und digitale Gestaltung: Tyrolia-Verlag, Innsbruck
Druck und Bindung: CPI Moravia Books, Tschechien
ISBN 978-3-7022-3550-5 (gedrucktes Buch)
ISBN 978-3-7022-3551-2 (E-Book)
E-Mail: buchverlag@tyrolia.at
Internet: www.tyrolia-verlag.at
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
Guten Tag, sagte der kleine Prinz und setzte sich zu mir ins Vorwort.
Guten Tag, sagte ich etwas verwirrt, weil ich es nicht gewohnt war, dass man mich in einem Vorwort besuchte.
Was ist das hier, fragte der kleine Prinz und blickte sich um.
Das ist ein Vorwort, sagte ich.
Was ist ein Vorwort?
Ein Vorwort ist wie ein kleiner Garten mit einem Weg, der ins Haus des Buches führt, sagte ich. Das hatte ich irgendwo gelesen.
Ich mag kleine Gärten, sagte der kleine Prinz und dachte wohl an seine Rose.
Wir schwiegen ein wenig und ich schrieb ein paar Zeilen.
Was ist dann in dem Haus?, fragte der kleine Prinz nach einer kleinen Weile.
Welches Haus?, fragte ich verwirrt, weil ich doch mit Schreiben beschäftigt war.
Nun, das Haus, in das dieses Vorwort hineinführt.
Ja, richtig!
Das Buch baut ein Haus über die Liebe, sagte ich vorsichtig. Ich will die Frage erkunden, was es denn heißt, einen Menschen zu lieben.
Der kleine Prinz dachte kurz nach.
Ich liebe den Fuchs, sagte er dann.
Wieder Nachdenken.
Und ich glaube: Den Fuchs zu lieben heißt, gut mit ihm allein sein zu können.
Das ist ein schöner Gedanke, sagte ich ein klein wenig gönnerhaft.
Oder, fuhr der kleine Prinz fort, den Fuchs lieben heißt, von ihm erzählen zu können.
Auch das ist ein Gedanke, der mir gefällt, kommentierte ich.
Dann könnte ja eigentlich ich ein Buch über den Fuchs schreiben, meinte der kleine Prinz, und von ihm erzählen.
Ja, das könntest du, sagte ich nun etwas verunsichert.
Da würde ich anfangen müssen bei meinem Planeten, erklärte der kleine Prinz, und bei meiner Reise und ich würde erzählen von all dem, was ich zurückgelassen habe und von allen, die ich auf dem Weg kennengelernt habe.
Das will ich auch, sagte ich begeistert.
Einen Menschen zu lieben, heißt Vertrautes zurücklassen, von einem Planeten aufbrechen, eine Reise tun und ankommen.
Ich weiß nicht mehr, ob das der kleine Prinz gesagt hat oder ich. Jedenfalls endet hier das Vorwort mit einem herzlichen Dank an Gottfried Kompatscher und mit einer innigen Widmung an meine geliebte Frau Maria. Wem sonst soll ich ein Buch über die Liebe zueignen?
Für Dich, also, geliebte Maria, für Dich.
Salzburg, im Sommer 2016
ZUR EINLEITUNG
„WIE REDEST DU WIRKLICH?“
„Mit jedem Menschen redest du anders“, sagt ein Kind zu seinem Vater in einem Kinderbuch aus meiner Volksschulzeit; der Vater spricht anders mit der Mutter als mit der Nachbarin (gut so!), wieder anders mit dem Schulwart und wieder anders mit einem Patienten in seiner Zahnarztpraxis. „Wie redest du wirklich?“, fragt der Bub.
Der Vater weiß darauf keine Antwort. Denn es gibt keine „eine, wirkliche“ Sprechweise; tatsächlich reden wir mit unseren Geschwistern daheim anders als mit einer Ärztin im Krankenhaus oder mit einem Angestellten am Fahrkartenschalter. Wir sprechen stets mit „gleichwürdigen“ Menschen, mit Menschen, die gleich an Würde sind, aber wir tun es in ganz unterschiedlicher Weise. Und eben dies ist Ausdruck von Respekt.
Wir sprechen mit einem Menschen, der uns nach dem Weg fragt, anders als mit einem Menschen, den wir nach dem Weg fragen; wir sprechen mit einer Polizistin anders als mit einem Kellner. Wir drücken die Achtung vor einem Menschen dadurch aus, dass wir mit ihm in einer einzigartigen Weise umgehen. Wir alle, die wir uns im öffentlichen Raum bewegen, müssen viele Sprachen sprechen können, müssen vielsprachig sein.
FREMDSPRACHEN LERNEN
Fremdsprachenlernen ist harte Arbeit. Die englische Philosophin Iris Murdoch hat versucht, während des Zweiten Weltkriegs Russisch zu lernen. In ihrem Tagebuch berichtet sie am 8. November 1942 von ihren Erfahrungen: Ich nehme Russischstunden bei einem alten Armenier, einem politischen Flüchtling. Er spricht kein Wort Englisch, was bedeutet, dass alles auf Russisch ablaufen muss; das gibt mir eine exzellente Konversationspraxis. Er hat kein Verständnis für die Regeln der Grammatik …
Man kann sich vorstellen, wie abenteuerlich es für Murdoch gewesen sein muss, sich die russische Sprache anzueignen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser – hinein in eine rein russische Lernsituation, noch dazu begleitet von einem unerfahrenen Lehrer, der zwar Russisch beherrschte, aber nicht das Vermitteln der russischen Sprache.
Jahre später wird Murdoch in ihrem Hauptwerk über das Gute schreiben, dass das Lernen der russischen Sprache sie mit einer autoritären Struktur konfrontiert habe, die ihr Respekt abverlange. Die russische Grammatik lässt nicht mit sich handeln; Ludwig Wittgenstein, den Iris Murdoch persönlich gekannt hat, hat immer wieder davon geschrieben, dass eine Sprache nicht bis ins Letzte begründet werden kann; an einem bestimmten Punkt können wir nur sagen: „So sprechen wir!“, „Das ist unsere Sprache!“, „Das sind die Regeln der Grammatik!“ – hier kann man sich nur unterwerfen und zur Kenntnis nehmen, dass dies so ist.
So erkennt Iris Murdoch in ihren Überlegungen über das Erlernen der russischen Sprache: Es ist eine fordernde Aufgabe und das Ziel ist in weiter Ferne und vielleicht nie wirklich erreichbar. Die Arbeit ist eine beständige Offenbarung von etwas, das unabhängig von ihr ist. Aufmerksamkeit gegenüber dieser Wirklichkeit wird mit Wissen von dieser Wirklichkeit belohnt. Die Liebe zum Russischen führt mich, so Iris Murdoch, weg von mir selbst, hin auf etwas, was mir fremd ist, hin zu etwas, das mein Bewusstsein nicht einfach übernehmen oder schlucken, verneinen oder in seiner Wirklichkeit leugnen kann.
DIE VIELEN SPRACHEN DER LIEBE
Eine Sprache zu lernen verlangt nach Demut, nach Ausdauer und Geduld, aber ebenso nach Selbstvergessenheit. Das sind auch wichtige Elemente in unserem Bemühen, einen Menschen zu lieben. Einen Menschen zu lieben ist wie das Erlernen einer Fremdsprache. Da braucht es die Anerkennung, dass da jemand ist, der von mir unabhängig ist; da ist jemand, der nicht von meinem Willen abhängt, sondern ein Eigenleben hat. Einen Menschen zu lieben heißt entdecken, dass da ein Gegenüber ist.
Einen Menschen zu lieben ist wie das Erlernen einer Fremdsprache. Diesen Gedanken kann man bei Iris Murdoch finden; sie ist schließlich auch jene Philosophin, die einmal geschrieben hat: „Liebe ist die extrem schwierige Anerkennung, dass etwas anderes als ich existiert.“ Diese Worte hat sich Iris Murdoch, die einen brillanten Geist und einen großen Sinn für Unabhängigkeit hatte, abgerungen; Lieben heißt, dass da jemand ist, der sich deiner Kontrolle entzieht; lieben heißt sehen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die unabhängig von dir ist. Für Iris Murdoch, die mit „Bindung“ und „Loslassen“ ihre Schwierigkeiten hatte, waren dies schwer erkämpfte Einsichten.
Bleiben wir bei diesem Gedanken: Einen Menschen zu lieben ist wie das Erlernen einer Fremdsprache; Gary Chapman hat diesen Gedanken auch verfolgt: Du musst die Muttersprache des geliebten Menschen lernen, wenn du mit ihm zusammensein willst. Und wenn wir mit verschiedenen Menschen liebevoll umgehen wollen, dann müssen wir viele Sprachen lernen. Denn jeder Mensch, so scheint es, will auf je eigene Weise geliebt werden.
Manche Menschen liebst du dadurch, dass du langsam sprichst; andere Menschen liebst du dadurch, dass du wenig sprichst; wieder andere dadurch, dass du viel erzählst, schnell redest … Die Liebe kennt viele Sprachen. Und das ist auch gut so. Denn wir alle sind verschieden; es gibt sie nicht, die „eine, wirkliche Sprache der Liebe“. Eine nüchterne Hebamme liebt eine gebärende Frau anders als ein behutsamer Seelsorger einen Sterbenden, dem er die Hand hält; Eltern lieben ihr zweijähriges Kind auf andere Weise, als sie Jahre später dasselbe Kind in seinen Pubertätsjahren lieben werden. Und das ist gut so.
Viele Menschen, viele Sprachen der Liebe – wer mit vielen Menschen oder auch mit einem Menschen in verschiedenen Lebenssituationen umgeht, muss vielsprachig sein, muss viele Sprachen der Liebe beherrschen; man könnte das geradezu als Lebensziel ansehen: vielsprachig werden in Sprachen der Liebe, „polyglott“ zu sein in der Liebe.
Man könnte das Bemühen um ein gutes Leben in dieser Anstrengung gipfeln lassen: Ein gutes Leben führt, wer in den vielen Situationen des Lebens stets Sprachen der Liebe zu sprechen vermag; es ist ja einigermaßen bemerkenswert, dass so viele Religionen und spirituelle Traditionen darin übereinstimmen: Der Weg des Menschen ist die Liebe; der Weg zur Menschlichkeit ist die Liebe; der Weg, der über das bloß Menschliche hinausführt, ist die Liebe.
DIE LIEBE ALS SPRACHE
Bleiben wir bei diesem Bild – die Liebe als eine Sprache: Eine Sprache ist eine Einrichtung, mit der wir unser Verhalten und unsere Interessen auf das Verhalten und auf die Interessen anderer Menschen abstimmen können. Eine Sprache hat einen Wortschatz, sie hat eine Grammatik, und Menschen entwickeln einen je eigenen Stil, wenn sie sich eine Sprache aneignen.
Die Liebe ist wie eine Sprache, die „mein“ mit „dein“ zusammenbringt; zwei Menschen, die einander lieben, gehen eine Verbindung ein, die „mein“ Leben und „dein“ Leben aufeinander abstimmt und aufeinander hin ausrichtet.
Die Liebe spricht viele Sprachen – in Ingeborg Bachmanns Gedicht Erklär mir, Liebe heißt es, „dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein“. Immer neue Sprachen eignet sich die Liebe an.
Die Liebe spricht viele Sprachen und jede Sprache hat einen Wortschatz. Der Wortschatz der Liebe, das sind die Bedeutungseinheiten, in denen sich die Liebe ausdrückt; das kann der besorgte Blick sein, der Blick des Kindes auf die demenzkranke Mutter oder der Blick des Vaters auf das fiebrige Kind; das kann eine zärtliche Geste sein, über die Wange streicheln, die Hand nehmen, auf die Stirn küssen; das kann das sorgsam ausgesuchte Geburtstagsgeschenk sein, ein langsam geschriebener Brief, ein Abendgebet. Dieser Wortschatz ist bei jedem einzelnen Menschen anzupassen; das kann man sehr schön an Geschenken sehen, die Freude machen sollen; ein vierzehnjähriges Mädchen freut sich in der Regel nicht mehr über eine Puppe, eine Krawatte mag den Rektor der Universität Salzburg freuen, nicht aber ein Mitglied einer Punkrockband. Es ist gut, den Wortschatz zu erweitern, über ein breites Repertoire an Ausdrucksformen zu verfügen.
Eine Erweiterung des Wortschatzes kann man auch lernen – ähnlich wie man sich die Sprache zur Beurteilung von Wein aneignen kann und dann geschliffen von „vielschichtigem Bukett“, „präsenter Struktur“ oder „holzbetontem Rückgeruch“ reden kann. Den Wortschatz der Sprachen der Liebe kann man ausbauen; man kann lernen, Verlässlichkeit zu zeigen, man kann lernen zu überraschen, man kann lernen, einen Brief zu schreiben … Natürlich gibt es auch „Grundvokabeln“ einer jeden Sprache der Liebe, das sind etwa die Ausdrucksformen und Absichten, die wir mit den Worten „Bitte“, „Danke“ oder „Entschuldigung“ ausdrücken. Wer diese Vokabeln beherrscht, hat schon viel gewonnen.
Die Liebe hat auch eine Grammatik, folgt bestimmten Regeln; diese Regeln haben grundsätzliche Ähnlichkeiten (jeder Mensch will mit Achtung und Aufmerksamkeit behandelt werden), aber auch Eigenarten. Meine Tante, geboren mit Trisomie 21 (Down-Syndrom), wurde vor allem dadurch geliebt, dass man sie zum Lachen brachte; meine Großmutter väterlicherseits hätte dies möglicherweise als Anmaßung empfunden; in einer Sprache der Liebe gilt, „du darfst den anderen Menschen berühren“, in einer anderen Sprache ist die Regel zu respektieren: Liebe zeigt sich im höflichen „Sie“. Kinder kommen in ein Alter, in dem sie nicht mehr in der Öffentlichkeit von den Eltern liebkost werden wollen. Das sind Regeln – die sich wandeln, über die man sich auch unterhalten kann, die geändert werden können, die aber dennoch binden und ordnen.
Schließlich will nicht nur jeder Mensch auf je eigene Weise geliebt werden, es hat auch jeder einzelne Mensch einen je eigenen Stil in der Liebe wie im Leben; manche Menschen sind impulsiv, andere überlegt; manche sind zögerlich, andere entscheidungsfreudig; König Herodes musste seine Liebe (oder das, was er für Liebe hielt) zu Herodias dadurch ausdrücken, dass er ihrer Tochter den Kopf des Johannes auf einer Schale übergab (ich beeile mich hinzuzufügen, dass wir uns noch überlegen werden müssen, ob wir bereit sind, dies „Ausdruck von Liebe“ zu nennen). Es gibt viele Weisen, einen Heiratsantrag zu machen; es gibt viele Weisen, einen 80. Geburtstag zu feiern; es gibt viele Weisen, Freundschaft zu einem Menschen anzubahnen. Das ist auch eine Frage des persönlichen Stils. Erich Kästner zeichnet Dr. Johann („Justus“) Bökh als Schularzt, der die Kinder dadurch liebt, dass er sie mit großem Respekt behandelt, ihnen pfeifenrauchend zuhört, Zeit schenkt und für sie da ist – und einen tiefen Sinn für Gerechtigkeit hat (deswegen der Spitzname „Justus“). Liebe ist also auch eine Frage des persönlichen Stils.
EIN KURS ÜBER DIE SPRACHEN DER LIEBE?
Wie wäre es nun, wenn wir einen Kurs über die vielen Sprachen der Liebe anbieten würden? Einen Kurs mit allem Drum und Dran, der es den Teilnehmenden erleichtern soll, im Alltag und in außergewöhnlichen Lebenssituationen liebevolle und liebenswürdige Menschen zu sein. Ähnlich wie Helen Schucmans Kurs in Wundern wäre es ein Kurs, der das Leben der Menschen von Grund auf verändern, sie zu einer neuen Lebensausrichtung bringen sollte.
Am Anfang eines solchen Kurses stünde natürlich eine Grundentscheidung: Will ich in der Liebe wachsen? Will ich mein Leben in den Dienst der Liebe stellen? Will ich mein Leben nach der Kunst der Liebe ausrichten?
Dann bräuchte es ein Verständnis von Sprache und es bräuchte bestimmte Hilfsmittel. Eine Sprache hat, wie wir gesehen haben, einen Wortschatz, Regeln der Grammatik und jede Sprecherin, jeder Sprecher hat einen eigenen Stil. Für das Erlernen einer Sprache brauchen wir Hilfsmittel: Ich muss mit einem Lehrbuch Vokabeln lernen und die grundlegenden grammatischen Regeln; ich brauche sprachkundige Begleiter und Begleiterinnen, die mich auch auf häufige Fehler aufmerksam machen; ich brauche die Erfahrung von einschlägigen Gesprächssituationen; zu diesem Zweck sind Reisen in das Land, in dem die Sprache gesprochen wird, hilfreich. Hilfreich ist es auch, über gängige Fehler Bescheid zu wissen – es ist etwa ein Fehler zu glauben, Lieben kann man so ohne weiteres, man benötige einzig ein geeignetes Objekt. Es ist auch ein Standardfehler zu glauben, dass Liebe vor allem eine Frage der Gefühle oder gar von Gestimmtheiten sei. Solche Fehler könnte man in einem Kurs besprechen.
Ich würde einen solchen Kurs wahrscheinlich in sechs Schritten angehen:
1)Ich würde zuerst von konkreten Situationen ausgehen – beginnend mit einfachen (eine neue Familie zieht in die Nachbarwohnung ein) und übergehend zu anspruchsvolleren Situationen (ein Elternteil wurde in einem Krankenhaus schlecht behandelt oder ein Mitarbeiter muss entlassen werden); wichtig scheint hier die ausgewogene Diät an Beispielen zu sein, das Berücksichtigen von vielen verschiedenen Situationen, in denen sich Liebe „trotz allem“ zeigt.
2)Ich würde einladen, über Bilder nachzudenken und daran Fragen zu knüpfen – was sind Bilder für die Liebe? Etwa das Bild des Hauses (einen Menschen zu lieben ist wie das Bauen eines gemeinsamen Hauses) oder das Bild des Gartens (einen Menschen zu lieben ist wie das Pflegen eines Gartens, der Ordnung und Sicherheit bietet, aber auch immer wieder Überraschendes, Blühendes und Neues). An diese Bilder kann man Fragen anschließen: Was ist beim gemeinsamen Hausbau zu beachten, etwa in Bezug auf Umsicht und vorausschauendes, langfristiges Denken? Wie pflegt man einen Garten, sodass die Pflanzen wachsen und gedeihen?
3)In einem dritten Schritt würde ich „das Bedeutungsfeld“ von Liebe abstecken – welche Begriffe sind wichtig, will man den Begriff der Liebe gut und tief verstehen? Etwa: Freude, Höflichkeit, Achtung, Feinfühligkeit, Sorge, Bindung, Dankbarkeit. Über jeden Begriff würde ich nachdenken – Freude als Frucht der Liebe etwa ist ein „ starkes Ja zum Leben, das die Kraft hat, die Wirklichkeit zu verändern“, Höflichkeit als ein Ausdruck von Liebe ist behutsamer Umgang mit Menschen, der Zeit und Raum lässt. Achtung als grundlegende Sprache der Liebe ist die aufmerksame Anerkennung, dass andere Menschen mich zu etwas verpflichten. So würde ich mich dem Begriff der Liebe über andere Begriffe annähern.
4)Viertens würde ich in einem Kurs über die Liebe Theorien oder Zugänge zur Liebe vorstellen, vor allem drei: Einen Menschen zu lieben bedeutet, dass ein Ich einem anderen Ich zum Du wird und dadurch ein Wir entsteht; dieses Wir bedeutet, dass das Wohl der einen Person mit dem Wohl der anderen Person verbunden ist und dass mehr und mehr Sätze in der ersten Person Plural (Wir-Sätze) gebildet werden können. Eine zweite Annäherung: Einen Menschen zu lieben bedeutet, sich für starke und tätige Sorge für diesen Menschen zu entscheiden; hier hat Liebe mit Verantwortung und Bindung zu tun. Und eine dritte Überlegung: Einen Menschen zu lieben bedeutet, in ihm einen Wert zu sehen, den andere nicht sehen. Das nennt man manchmal die Wert-Theorie der Liebe. Alle haben etwas für sich und helfen im Verstehen der Liebe.
5)In einem Kurs über die Liebe würde ich dann Beispiele nahebringen, Beispiele von Meisterinnen und Meistern der Liebe, Beispiele von Menschen, von denen man so viel über die Kunst der Liebe lernen kann; ich kann hier etwa an Betsie ten Boom denken, die durch Verrat ins Konzentrationslager Ravensbrück gekommen ist und keinen Hass auf den Verräter empfand, sondern nur Betroffenheit: Was muss dieser Mensch für Wunden tragen, dass er zu so etwas fähig ist! Ich kann hier von Pedro Arrupe erzählen, der ein heiligmäßiger Mensch war und auch denjenigen, die ihm geschadet haben, großzügige Gastfreundschaft gewährte. Ich kann auch von unserer Freundin Felicia erzählen, die gerade auch in Krankheit und Tod eines Kindes eine Autorität in der Liebe ausstrahlt. Solche Beispiele liefern dichte Beschreibungen eines liebevollen Lebens; sie schenken uns Anhaltspunkte und einen Sinn für Weite.
6)Schließlich dürfen in einem Kurs über die Liebe konkrete Übungen nicht fehlen. Es mag eine gute Übung sein, ein Liebestagebuch zu führen und jeden Abend darüber nachzudenken, wie man in bestimmten Situationen gehandelt hat, ob es Fortschritte auf dem Weg zur Liebe gibt. Eine gute Übung mag auch die Vorbereitung auf den Tag sein, in der man sich einstellt, liebevoll zu handeln. Empfehlenswert ist sicher auch das Bauen an guten Gewohnheiten, die es leichter machen, den Alltag liebevoll zu gestalten, die Gewohnheit eines gesunden Lebensrhythmus, der grundsätzlich Gelassenheit ermöglicht, oder die Gewohnheit, niemals im Zorn zu reden oder zu schreiben, sondern durchzuatmen und Zeit verstreichen zu lassen. Eine gute Übung könnte eine „kleine Autobiographie der Liebeserfahrungen“ sein – wann hast du wie über die Liebe gelernt? Was sind wichtige Erfahrungen, bedeutsame Sätze, gewichtige Situationen? Eine gute Übung ist auch die Suche nach Versöhnung mit Menschen, das gezielte Bemühen darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und die Vergangenheit zu heilen. Kein Zweifel: diese Übungen sind echte und anstrengende Arbeit an uns selbst, aber das wäre ein Kurs über die Liebe in jedem Fall. Ein Kurs ist wie eine Reise, die ein Ziel hat, an dem man aber nie endgültig ankommt.
EINE REISE MIT VIELEN STATIONEN –
ODER IN VIELEN BRIEFEN
Ein Leben, das sich um die Liebe bemüht, ist eine Reise, ein Weg. Ein Band der Tagebücher von Thomas Merton, nach seinem Tod veröffentlicht, trägt den Titel Learning to Love, „Lernen zu lieben“. Das ist ein schönes Bild: Hier lesen wir vom Ringen eines Menschen, der versucht hat, in seinem Leben das Lieben zu lernen; weniger dadurch, dass er auszog, als dadurch, dass er einzog, Einkehr hielt in sich selbst. Ja, man kann das Leben sehen als eine Lernreise auf der Suche nach der Kunst der Liebe. Man könnte sich einen solchen Lernweg als eine Reise vorstellen; ähnlich wie die Reise des kleinen Prinzen, die Antoine de Saint-Exupéry beschrieben hat.
Man könnte sich einen Lernweg zur Liebe aber auch als „Reise in Briefen“ vorstellen, als das Abfassen von Briefen an Menschen, die man liebt. Ein solcher Brief kann ein Feuerwerk sein, aber auch wie eine tiefe Wunde; wenn man Franz Kafkas Briefe an Milena liest – „ich lebte von deinem Blick“ –, kann das schmerzhaft sein, er ringt mit seiner Liebe, dem Nichtzugebenkönnen des Ausmaßes dieser Liebe und der Einsicht, dass Milena für ihn so viel mehr bedeutet als er für sie. Kafka denkt an sie und „über-denkt“, übertreibt das Denken, wie wir einem Brief vom April 1920 aus Meran entnehmen können: „Liebe Frau Milena, von Prag schrieb ich Ihnen einen Zettel und dann von Meran. Antwort bekam ich keine. Nun waren ja die Zettel keiner besonders baldigen Antwort bedürftig und wenn Ihr Schweigen nichts anderes ist als ein Zeichen verhältnismäßigen Wohlbefindens, das sich ja oft in Abneigung gegenüber dem Schreiben ausdrückt, so bin ich ganz zufrieden. Es ist aber auch möglich – und deshalb schreibe ich – daß ich Sie in meinen Zetteln irgendwie verletzt habe (welche gegen allen meinen Willen grobe Hand hätte ich, wenn das geschehen sein sollte) oder, was freilich noch viel schlimmer wäre, daß der Augenblick ruhigen Aufatmens, von dem Sie schrieben, wieder vorüber und wieder eine schlechte Zeit für Sie gekommen ist.“ – Kafka quält sich und quält sie mit seinen Selbstzweifeln. Das zu lesen tut weh; schmerzhaft kann auch die Lektüre der Briefe von Hilde Domin an ihren Ehemann Erwin Walter Palm sein, der mit der Begabung und dem Erfolg seiner Frau seine Schwierigkeiten hatte. Hier ringen „Ich“ und „Du“ und „Wir“ miteinander.
Berührend ist es, die vielen Briefe zu lesen, die Lew und Swetlana Mitschtschenko einander zwischen 1946 und 1954 geschrieben haben, etwa zweimal pro Woche. Lew war nach den Irrungen und Wirrungen des Krieges zu einer zehnjährigen Haftstrafe in einem Gulag verurteilt worden; in den Briefen richten sie einander auf, wollen einander Gutes und sagen einander das Gute zu; im Jahr 1949 kann Lew etwa schreiben: „Ich möchte, dass Du häufiger lächelst, öfter singst oder etwas vor Dich hin summst und dass Du die Augen ein wenig zusammenkneifst, wie Du es tust, wenn Du etwas lustig findest, oder dass Du sie, mit einem leichten Stirnrunzeln, weit öffnest, weil Du etwas siehst, das Dich glücklich macht.“ Die Briefe, mit denen sie einander Mut machen („wir werden dies durchstehen“), hat der britische Historiker und Russlandexperte Orlando Figues gesichtet und in Übersetzung herausgegeben. Die Briefe sind ein beredtes Zeugnis dafür, dass die Liebe zu einem Menschen diesen Menschen zum selbstverständlichen Teil und Bezugspunkt des eigenen Lebens machen kann; so kann Lew in einem Brief an Swetlana auch schreiben: „Du warst meine Welt und wirst meine Welt bleiben, und was Du auch warst, für mich wirst Du immer meine Swet, mein Licht, sein“ – und Jahre später, nach einem Besuch: „Du bist immer noch überall bei mir. Wenn mir etwas Schönes einfällt – eine Melodie oder ein Vers von Puschkin oder Burns oder ein Gemälde –, denke ich stets an Dich und habe Dein Gesicht und Deine Augen vor mir.“
Um eine Reise zur Liebe in Briefen geht es in diesem kleinen Buch. Es sind Briefe aus Liebe und Briefe über die Liebe; Briefe an die Nächsten der Familie, Briefe an Lehrerinnen und Meister der Kunst der Liebe, schwierige Briefe und kurze Briefe. Die wichtigsten Anhaltspunkte werden in einem abschließenden Wörterbuch gesammelt. So sollen Pflastersteine für einen Weg zu Sprachen der Liebe zusammengetragen werden. Es ist vor allem eine Einladung, das Erlernen dieser Sprachen ernst zu nehmen und die „Liebe zur Liebe“ zu entdecken.
Darmowy fragment się skończył.