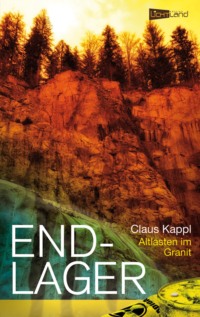Czytaj książkę: «Endlager»
edition lichtland
Für Carin
© Claus Kappl
edition Lichtland
Stadtplatz 4, 94078 Freyung
Deutschland
Umschlaggestaltung: Edith Döringer
Umschlagfoto: Georg Knaus
Foto radioactive barrels: bioraven/Shutterstock.com
ISBN: 978-3-942509-23-7
eISBN: 978-3-942509-89-3
Claus Kappl
ENDLAGER
Altlasten im Granit
Kommissar Kleintalers zweiter Fall

Die Personen
| Johannes Behr | Landwirt |
| Maria Behr | seine Frau |
| Christoph Behr | Sohn |
| Jakob Lechner | Schreiner |
| Dr. Hanno Bauernfeind | Polizeihauptkommissar |
| Johann Häusl | Polizeihauptkommissar i.R. |
| Georg Stiefelbeck | Polizeimeister |
| Thomas Höpfner | Polizeimeister |
| Tina Hartmann | Polizeimeisterin zur Anstellung |
| Otmar Papke | Diplomingenieur |
| Dr. Gabriele Vohland | Agraringenieurin |
| Felix Liggner | Schreiner |
| Georg Kleintaler | Polizeikommissar |
| Marianne Kleintaler | seine Frau |
| Martha Gabler | Marianne Kleintalers Tante |
Handlung und Personen sind frei erfunden.
Mögliche Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen entspringen allein der Phantasie des Lesers.
Inhalt
Prolog
Granit
Epilog
Prolog
Die Luft roch schon nach Frieden an jenem milden Donnerstagmorgen, man schrieb den 26. April im letzten Kriegsjahr.
Der zehnjährige Johannes Behr stand fröstelnd auf der untersten Stufe jener breiten Steintreppe, die zur Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul empor führte. Zwar schien die Frühlingssonne bereits warm vom Himmel, Johannes stand jedoch im Schatten des mächtigen Bayerwalddomes, dem Wahrzeichen der niederbayerischen Stadt Waldkirchen, und spürte die kalte Luft, die von den Granitquadern abstrahlte. Das buntkarierte, kurzärmelige Hemd und die knielange Drillichhose wärmten ihn kaum, seine kleinen Füße steckten in alten, spreißeligen Holzschuhen. Johannes fror aber noch aus einem anderen Grund, er fror aus Angst. Heimlich hatte er sich von zuhause weggeschlichen, sich vor der verhassten Stallarbeit gedrückt, fürchtete schon jetzt die drohende Strafe des jähzornigen Vaters.
Johannes wartete bereits seit einigen Minuten auf seinen Freund Jakob Lechner. Erst gestern hatten sie sich verabredet, nach der Trauungszeremonie, die gerade in der Kirche vor sich ging, dem Brautpaar symbolisch den Weg zu versperren, um sich ein paar Pfennige Taschengeld hinzu zu verdienen. Geld war rar in diesen Zeiten, aber Brautleute waren zumindest an ihrem Jubeltag großzügig. Johannes wusste mittlerweile, dass er vergeblich wartete. Sicherlich hatte der ängstliche Jakob seinen Vater um Erlaubnis für dieses Unternehmen gefragt, die dieser ihm verweigert hatte. Und mit Recht, wie Johannes sich eingestehen musste, denn seit gestern standen „die Amerikaner“, stand die 11. US-Panzerdivision am Sicklinger Berg, hatte Röhrnbach schon eingenommen, und die Besetzung Waldkirchens war nur eine Frage von Stunden. Auch er hatte Angst vor dem Kommenden, obwohl noch alles ruhig war, weder Gewehrfeuer noch Panzergeräusche zu hören waren.
Johannes, der schon recht kräftig für sein Alter war, hatte das eine Ende seines mitgebrachten Kälberstricks mit einem Stein auf der Stufe befestigt, das andere Ende hielt er in der Hand. Er blickte hinauf zur Kirchturmuhr, es war fünf Minuten vor zehn. Hinter der verschlossenen Eichentür der Kirche verklang die Orgelmusik, die Trauungsmesse war vorüber, gleich musste das Brautpaar erscheinen. Tatsächlich öffneten sich in diesem Augenblick die schweren Flügel der Kirchentür, einige eilige Besucher liefen die Treppe hinab, stürmten nach Hause aus Angst vor dem Krieg, der für sie jetzt greifbar wurde. Der kleine untersetzte Pfarrer erschien, hinter ihm das Brautpaar. Wer in diesen unruhigen Zeiten heiratete, musste Gründe haben. Johannes wusste beim Anblick der Braut, trotz seines geringen Alters, Bescheid. Das schlichte weiße Brautkleid, vermutlich von einer Freundin geliehen, spannte über dem Bauch verdächtig. Die Braut war bereits in gesegneten Umständen, „überständig“, wie der Volksmund sagte, und wollte nicht ins Gerede kommen. Ihr Ehemann, der in Waldkirchen in Friedenszeiten als Bäckergeselle arbeitete, stand in der feldgrauen Uniform der Fallschirmjäger neben ihr. Johannes erkannte dies an den Epauletten und den beiden übereinanderliegenden Adlerschwingen am Revers. Vermutlich hatte er für seine Hochzeit ein paar Tage Fronturlaub bekommen. Tage, die ihm das Leben retten konnten. Der Pfarrer gratulierte dem Brautpaar noch einmal und verschwand dann im Innern der Kirche. Langsam stiegen die frisch getrauten Eheleute die Stufen hinunter, gefolgt von nur wenigen Verwandten. Johannes zog den Strick straff und lächelte das Brautpaar an. Seine lustigen blauen Augen heischten um Verständnis, verfolgten die Hand des Bräutigams, die langsam in die linke Uniformtasche glitt, Johannes erwartete eine kleine Belohnung.
Die Hand blieb jedoch mitten in der Bewegung stehen, wurde aus der Jackentasche herausgerissen, ergriff den rechten Arm der Braut und zog sie die letzte Stufe hinunter. „Tieffliegerangriff“, schrie der Bräutigam und suchte mit seiner Ehefrau Schutz an den Mauern des gegenüberliegenden Geschäftshauses. Johannes ließ den Strick fallen und rannte die Treppe nach oben, flüchtete sich hinter die Kirchentür. Der erwartete Beschuss blieb jedoch aus, statt dessen ertönte vom Karoli-Berg her das dumpfe Feuer einer Vierlingsflak, die das amerikanische Aufklärungsflugzeug unter Beschuss nahm.
Johannes hatte zum ersten Mal den Todeshauch des Krieges gespürt. Er zitterte, war unfähig zu weinen und wusste nur, dass er schleunigst nach Hause gehen musste. Vorsichtig blickte er von seinem Versteck aus auf den Marktplatz. Kein Mensch war zu sehen, auch die Hochzeitsgesellschaft schien spurlos verschwunden zu sein. Johannes rannte die Treppen hinunter, sprang über den Marktbach und befand sich im Schutz der oberen Bürgerhäuser, als der Artilleriebeschuss des Marktes begann. Salven um Salven schlugen nun in die Häuser auf der rechten Marktseite ein. Tief geduckt hastete Johannes weiter. Der Bauernhof seines Vaters hinter der Geier-Mühle schien ihm unerreichbar weit. Beim Schreibwarengeschäft musste er links zur Passauer Straße abbiegen, aus dieser Richtung kam der Beschuss. Johannes verharrte, vernahm den pfeifenden Einschlag einer Granate im Haus gegenüber. Mauern barsten, Mörtelstaub verklebte Augen und Nase, er hustete würgend.
In diesem Augenblick vernahm er eine helle Stimme hinter sich: „Do drieben is de Nebendüre offen, gomm, da versteggen ma uns.“ Ein etwa achtjähriges Mädchen kauerte hinter ihm, Johannes wusste nicht, woher sie plötzlich gekommen war. Sie nahm ihn an der Hand und zerrte ihn zur offenen Tür des Schreibwarengeschäftes, zog ihn in das vermeintlich sichere Gemäuer. Während schweres Artilleriefeuer den Marktplatz mit Beschuss belegte, atmete Johannes auf und besah sich die Kleine, die neben ihm kauerte. Ihr schmales, blasses Gesicht, eingerahmt von rötlich blonden Locken, der Blick ihrer grünen Augen ließen ihn ruhiger werden, nahmen ihm ein wenig die Angst. Sie trug ein blaues Kleid, das aus einer alten Uniform genäht war. „Wer bist du denn?“, flüsterte Johannes.
„Ich bin die Anna“, antwortete sie in schönstem Sächsisch. „Du brauchst keine Angst zu haben, Luftangriffe habe ich in Dresden schon erlebt. Da sind wir ausgebombt worden. Deshalb hat man mich auch hierher verschickt. Ich wohne oben in einer Baracke hinter der Mädchenschule. Ich wollte gerade Brot holen.“
„Was machen wir denn jetzt?“, fragte Johannes unsicher.
„Warten bis die Amerikaner kommen. Hier sind wir sicher.“
„Ich muss aber nach Hause. Wenn ich noch länger weg bin, dann erschlägt mich mein Vater“, flennte Johannes.
„Ach was, wenn du später gesund nach Hause kommst, ist er froh, dass du überhaupt noch lebst“, antwortete Anna lächelnd.
Johannes lauschte. Das Feuer war eingestellt worden. Er sah sich in dem kleinen Flur um. Eine Steintreppe führte in das Obergeschoss, eine braune Holztür versperrte den Blick in die hinteren Geschäftsräume. Johannes stand auf und versuchte die Holztür zu öffnen. Als er seine Hand auf die Türklinke legte, zerriss ein fürchterliches Pfeifen die Luft. Das Haus erzitterte, Mauern brachen. Johannes wurde von dem Granateneinschlag unter die Steintreppe geschleudert. Mörtelstaub nahm ihm die Sicht, Gesteinsbrocken prasselten herab, er vernahm einen gellenden Schrei. Dann war es plötzlich still.
Johannes wischte sich über die Augen. Rotz und Tränen hinterließen Spuren in dem staubverdreckten Gesicht. Feucht lief es ihm die Beine hinunter. Er hustete, erbrach sich. Nach einer kleinen Weile hatte sich der Staubnebel etwas gelichtet. Sein Blick suchte nach dem Mädchen.
„Anna? Anna, wo bist du?“
Er versuchte dorthin zurück zu kriechen, wo das Mädchen noch vor wenigen Minuten gekauert hatte. Gesteinsbrocken, Teile der Granittreppe versperrten ihm den Weg. Johannes kroch darüber, sah den Ausschnitt der Seitentür, der zur Hälfte weggerissen war.
„Anna! Anna! Wo bist du denn?“, krächzte er.
„Hier!“ Ein markerschütternder Schrei zerriss die Stille.
Und dann sah er sie. Sie lag unter einem Mauerteil, verschüttet bis zum Hals. Sie musste fürchterliche Schmerzen haben, denn sie schrie wie ein zu Tode verletztes Tier.
Ihr Schrei gellte in seinen Ohren. Johannes sah das schmerzverzerrte Gesicht, der Mund eine klagende Höhle. Er schloss die Augen, nicht fähig ihren leidenden Anblick zu ertragen. Dann war sie still.
„Hilf mir, so hilf mir doch!“ Ihre Stimme wurde leiser. Johannes kroch zu ihr. Seine Hände gruben in dem Schutt, warfen Gesteinsbrocken zur Seite. Die scharfen Kanten der Steine zerrissen seine Fingerkuppen, Blut rann herab, er merkte die Schmerzen nicht. In fiebriger Hast versuchte er Anna zu befreien. Vergebens!
Erneut zerriss ein Pfeifen die Stille, die Erde erbebte, die Mauern des zerstörten Hauses erzitterten. Ein fürchterlicher Lärm durchdrang das Eckhaus. In unmittelbarer Nähe musste es zwei Volltreffer gegeben haben.
Erneut schrie das Mädchen. „Hilf mir doch, bitte, es tut so weh!“
„Soll ich Hilfe holen?“ Johannes flennte.
„Ja, aber komm zurück!“
Er kroch zu der Tür, durch die sie noch vor wenigen Minuten gekommen waren, um Schutz zu suchen und blickte nach draußen. Ein älterer Bauer rannte geduckt vorbei, einen heulenden Jungen hinter sich herziehend. Johannes schrie ihnen zu: „Hierher, helft mir, ein Mädchen ist verletzt!“ Der Bauer drehte sich kurz zu ihm um, hetzte weiter. Ein lärmender Einschlag beendete ihre Flucht. Die Luft schien zu vibrieren, die beiden Körper wurden in die Höhe geschleudert, fielen auf die Straße zurück und blieben blutüberströmt und reglos liegen. Johannes presste seinen Kopf auf den Boden. Da gellte Annas Stimme wieder zu ihm herüber. Er kroch zu ihr zurück.
„Ich kann dir nicht helfen, Anna!“ Zitternd schüttelte er den Kopf.
„Bitte, tu etwas“, flehte sie.
Noch einmal versuchte er sie zu befreien, warf Gesteinsbrocken zur Seite. Er fand ihren rechten Arm, zog daran. Ein nicht enden wollender Schrei folgte. Er ließ den Arm los, der schlaff in den grauen Staub fiel. Anna schrie, weinte, dann wimmerte sie nur noch. Johannes wusste nicht, wie lange er schon neben ihr kauerte. Er sah die Blutbläschen auf ihren zitternden Lippen. „Die Zeit verblutet“, dachte er sich. Er schloss die Augen. Rot sickerte es in sein Unterbewusstsein, setzte sich fest, vergiftete ihn.
Irgendwann lag Johannes neben ihr, sah sie nicht mehr an, hielt sich nur die Ohren zu. Ihr monotones Wimmern fraß sich in ihm fest. Eine Ewigkeit später erhob er sich, kniete neben ihr. Er sah sie mit weit aufgerissenen Augen ungläubig an. Wie lange sollte sie noch sterben? Wie lange musste er ihr Leiden noch ertragen? Langsam tasteten sich seine kleinen Hände vor. Er spürte das Blut auf ihren Lippen an seinen Handflächen. Er verschloss ihr den Mund, wollte ihr Wimmern zurückdrängen, für immer in ihrer Brust bannen. Er drückte fest mit beiden Händen zu.
Stille.
Johannes wusste später nicht mehr, wie lange er so da gekniet hatte. Eine Ewigkeit und ein Menschenleben später kroch er aus dem völlig zerstörten Schreibwarengeschäft und hastete nach Hause.
Als er im Dämmerlicht des frühen Abends durch die breite Toreinfahrt auf den Hof schlich, erblickte ihn sein Vater. Der hünenhafte Mann ergriff ihn. Zwei schallende Ohrfeigen ließen den Kopf des Kindes hin und her pendeln. Wortlos packte er ihn und sperrte ihn in den dunklen, stinkenden Saukoben. Johannes schrie, schlug mit den Fäusten gegen die Tür. Er verstand den Vater nicht. Er lebte doch. Schreien und Weinen blieben unerhört, verkamen zu einem kläglichen Wimmern.
Stille.
Anna wurde nie gefunden.
Granit
„Schosi, du weißt schon, dass Tante Martha heuer ihren 80. Geburtstag feiert?“ Der Jubeltag ihrer einzigen Tante beschäftigte Marianne Kleintaler schon seit Wochen, und an diesem Freitagabend wollte sie mit ihrem Mann endlich die Geschenkfrage klären. Deshalb stürmte sie ins Wohnzimmer und sah, wie er stocksteif, geradezu paralysiert, auf dem Sofa vor dem Fernseher saß. In ungläubigem Staunen starrte er auf den Flachbildschirm. Als Marianne näher kam, hob er abwehrend die Hand, sah sie mit weit aufgerissenen Augen an und signalisierte ihr still zu sein. Sein Gesichtsausdruck spiegelte das Entsetzliche wider, über das die „Tagesschau“ eben berichtete. Marianne verstummte augenblicklich.
„Um 6.45 Uhr deutscher Zeit wurde Japan vom schwersten Erdbeben in seiner Geschichte erschüttert. Seismologen maßen eine Stärke von 9,0 auf der nach oben offenen Richter-Skala. Das Epizentrum lag im Pazifischen Ozean rund 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai und rund 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokio. Eineinhalb Stunden später löschte eine 16 Meter hohe Flutwelle weite Landstriche der japanischen Hauptinsel Honshu aus. In einem Reaktor des Atomkraftwerkes Fukushima ist Feuer ausgebrochen, das Notkühlsystem funktioniert offenbar nicht. Die Bewohner in der Umgebung des Kernkraftwerkes werden zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert.“
Marianne und Georg Kleintaler starrten ungläubig auf den Fernsehschirm. Sie sahen eine riesige Wasserwalze auf die Küste zurasen. Schiffe kenterten, zahllose Automobile tanzten auf dem Wasser, gingen in der Flut unter. Wohnsiedlungen wurden überspült und wie Streichholzschachteln weggerissen, Fabrikanlagen überflutet und zerstört. Auf einer gigantischen, schwarzen Welle strömte das, was vor Sekunden noch heil, intakt und lebendig gewesen war, vernichtet und tot ins Meer zurück. Aus einem Reaktorturm züngelten Flammen gegen den Himmel.
Marianne Kleintaler schlug sich die Hände vor ihr Gesicht, nicht sehen wollend, was sie sehen musste. Sie fand als erste ihre Sprache wieder. „Um Gottes Willen, da sind ja Tausende von Menschen ums Leben gekommen. Das ist ja fürchterlich.“
Georg Kleintaler räusperte sich, wollte etwas sagen. Ein heiseres Krächzen folgte. Er verstummte, schüttelte den Kopf. Nach ein paar Augenblicken gelang es ihm, sein Entsetzen in Worte zu kleiden.
„Es ist fürchterlich. Schau dir nur diese Bilder an. Was haben die Menschen getan, dass sich die Natur so an ihnen rächt?“
Das Fernsehbild wiederholte die Tsunamiwelle in unterschiedlicher Geschwindigkeit, aus verschiedenen Perspektiven. Ein Handyvideo reihte sich an das andere.
„Merkwürdig, dass du das sagst. Ähnliches habe ich mir damals bei dem „Weihnachts-Tsunami“ auch gedacht. Damals war ich der Meinung, dass es schlimmer nicht mehr kommen könnte, aber wenn ich diese Bilder sehe, dann kommen mir Zweifel. Vielleicht kommt es immer noch schlimmer, als man glaubt.“
„Da gebe ich dir Recht, denn ich glaube, dass das noch nicht das Schrecklichste war, was wir erleben werden, Marianne. Wenn das Atomkraftwerk wirklich brennt, dann steht Japan vor einer nuklearen Katastrophe. Denk mal an Tschernobyl. Das war vor fünfundzwanzig Jahren.“
Marianne erinnerte sich: Damals war in der Ukraine ein Atomreaktor explodiert. Riesige Landstriche um den Reaktor sind heute noch unbewohnbar. Eine Luftströmung hatte radioaktiven Regen von Osteuropa bis Skandinavien verbreitet. Noch heute sind Bayerwald- Schwammerl hoch belastet und die finnischen Rentiere werden noch in den nächsten hundert Jahren hell in den Polarnächten strahlen. Marianne erschauderte bei diesen Erinnerungen. Beide nahmen nur noch am Rande wahr, was ein kluger Moderator und seine sogenannten Experten in der sich anschließenden Sondersendung „Brennpunkt“ von sich gaben. Kleintaler fand allerdings, dass angesichts eines brennenden Kernkraftwerkes der Name „Brennpunkt“ durchaus etwas Realistisches besaß.
Es hätte ein ruhiges und vergnügtes Wochenende werden sollen, denn Georg Kleintaler hatte dienstfrei und deshalb für diesen Samstag mit seiner Frau einen Einkaufsbummel in Passau geplant. Marianne konnte jedoch die schrecklichen Bilder vom Vortag nicht vergessen und fand es pietätlos, ihrem Vergnügen nachzugehen, während in Japan Tausende von Menschen um ihre Verstorbenen trauerten. So räumten sie gemeinsam den Keller auf und „gartelten“, das heißt, sie bereiteten ihren Garten auf das nahende Frühjahr vor. Tags darauf brachen sie nach dem Mittagessen zu einer kleinen Wanderung auf.
Sie hatten vor wenigen Minuten ihr Auto vor dem Emerenz-Meier- Haus in Schiefweg abgestellt und sich auf den Weg zum Osterbach gemacht. Ihre Wanderung führte sie nun auf einem schmalen Pfad bachaufwärts und sie betrachteten, ehrfürchtig schweigend, das kleine, ruhig dahinfließende Gewässer. Die schon warme Märzensonne hatte ein erstes zartes Grün in die noch wintergraue Bachaue gezaubert. Buschwindröschen blühten vereinzelt und bildeten einen sanften Kontrast zu den hellgrünen Spitzen der ersten Sumpfgräser. Silberne Weidenkätzchen kündigten das beginnende Frühjahr an. Dort, wo der Osterbach langsam floss, verwandelten ihn die Sonnenstrahlen in ein silberglänzendes Wasserband. Kleintaler hatte seine schwarze Daunenweste ausgezogen und über die Schultern gehängt. Die warme Frühlingssonne und der leichte Anstieg hatten ihn ins Schwitzen gebracht.
„Marianne, genieße dieses herrliche Fleckchen Natur, so lange es ihn noch gibt“, unterbrach er unvermittelt ihre schweigsame Wanderung.
„Was soll das denn jetzt heißen?“
Marianne war neugierig geworden.
„Ich will ja nicht der Mühlhiasl von Waldkirchen sein“, entgegnete Kleintaler in Anspielung auf den „Waldpropheten des 18. Jahrhunderts“, der noch heute als Wahrsager große Wertschätzung bei den Bewohnern des Bayerischen Waldes genießt, „aber ich habe in den vergangenen Tagen viel nachgedacht. Wenn es in Japan tatsächlich zu einem „Super-GAU“ kommen sollte, dann werden wir die Auswirkungen deutlich zu spüren bekommen. Nicht wie du vielleicht meinst, so wie nach Tschernobyl, mit radioaktivem Regen.“
„Wie sonst, Schosi, ich verstehe nicht ganz, was du meinst.“
„Ich glaube, dass mit Fukushima das Ende des Atomzeitalters eingeläutet wird. Wenn der Reaktor außer Kontrolle gerät, werden die Politiker aus Angst nicht wiedergewählt zu werden, so schnell wie möglich ihre Atomkraftwerke loswerden wollen. Dann geht es um Energie, um Strom, dann geht es um Milliarden und Abermilliarden. Alternative Energie wird das alles beherrschende Thema der nächsten Jahre werden. Auch wir im Bayerischen Wald werden uns dieser Problematik dann nicht entziehen können.“
Marianne überlegte, zuckte mit den Schultern.
„Möglich, dass du Recht behalten wirst. Aber was hat das hier mit dem Osterbachtal zu tun?“
„Jede Gemeinde wird in Zukunft viel und billige alternative Energie erzeugen wollen. Und hier, wo wir gerade stehen, plant die Stadt Waldkirchen den Ohmühlstausee, ein Großprojekt, benannt nach dem Weiler Ohemühle. Weißt du, schon in den fünfziger Jahren hat man hier einen riesigen Stausee geplant. Selbst die Straße nach Freyung wurde schon als zukünftige Staumauer konstruiert. Gott sei Dank fehlte der Stadt bisher das notwendige Geld, um das Projekt zu finanzieren. Aber wie es scheint, will der Stadtrat – wer weiß aus welchen Gründen – jetzt wieder Schwung in diese Angelegenheit bringen. Und glaube mir, so schlecht sind die Realisierungsmöglichkeiten jetzt nicht mehr. Denn ich bin mir sicher, dass nach Fukushima staatliche Fördergelder für alternative Energieprojekte nur so fließen werden.“
„Heißt das, dass das ganze wunderschöne Tal hier überflutet würde?“ Marianne schüttelte bei diesem Gedanken entsetzt den Kopf. „Wem nützt das denn?“
„Offenbar will der Stadtrat zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits bekommt er billigen Strom aus einem Wasserkraftwerk, und andererseits verspricht er sich einen Schub für den schon recht brach liegenden Tourismus. Und außerdem, Marianne, Hand aufs Herz, welcher Bürgermeister möchte sich nicht mit einem Großprojekt, welcher Art auch immer, in den Annalen seiner Heimatgemeinde verewigen?!“
„Ach komm, Schosi, die Stadträte haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Man kann doch nicht diesen idyllischen Bachlauf mit all seinen Pflanzen und Tieren einfach unter Wasser setzen. Schließlich kommen doch die Touristen gerade wegen der intakten Natur zu uns und nicht, um einen künstlich angelegten See zu bewundern.“ Marianne schüttelte verständnislos den Kopf.
„Wenn du dich da mal nicht täuschst! Baue einen Jachthafen, erschließe noch einen Golfplatz, und schon ist den Touristen die Umwelt egal. Event-Tourismus ist angesagt. Und wenn du das alles schön verpackst, bekommst du Strom, Touristen und sehr viel Geld. Und Geld kann unser Waldkirchen immer brauchen.“
Schweigend und in Gedanken versunken machten sie sich auf den Heimweg. Als Kleintaler vor dem Auswanderer-Museum in Schiefweg sein Auto aufschloss, meinte Marianne selbstbewusst:
„Wenn die das mit dem Stausee ernst meinen, dann gründe ich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt. Und weißt du, in wenigen Jahren sind Stadtratswahlen, und die Stadträte wollen alle wiedergewählt werden...“ Seine Frau dehnte die letzten Worte genüsslich. Kleintaler nickte amüsiert, denn er wusste, dass, wenn Marianne sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, sich jeder Gegner warm anziehen musste.
Als Kommissar Kleintaler am Montagmorgen um sieben Uhr die Polizeidienststelle in Waldkirchen betrat, kreisten seine Gedanken noch immer um die Natur- und Umweltkatastrophe von Fukushima. Der Tsunami hatte nach ersten Schätzungen mindestens 6000 Menschenleben gekostet, in drei Reaktoren des Atomkraftwerkes drohte die Kernschmelze. Die Radioaktivität im Katastrophengebiet war vierhundertmal so hoch wie vor dem Tsunami. In Deutschland hatten die ersten Politiker die Abschaltung aller Kernkraftwerke gefordert. Kleintaler legte ein frisches Pad in die Kaffeemaschine und ließ sich erst einmal eine Tasse „Café crème“ in seine gelbe Kaffeetasse laufen, die der sinnige Spruch „Polizeidienst macht krank“ zierte. Dann warf er einen Blick in den Korb mit dem Posteingang und hielt die Luft an. Er entnahm einen an ihn persönlich adressierten Brief. Das weiße Kuvert trug den Aufdruck „Bayerisches Staatsministerium des Innern“. Kleintaler wurde mit einem Mal nervös. Das konnte nur die Antwort auf seine Bewerbung sein.
Der Dienststellenleiter der Polizeidienststelle Waldkirchen, Johann Häusl, dem Kleintaler viel zu verdanken hatte, war im Juni des vergangenen Jahres in den Ruhestand versetzt worden, und er hatte sich auf dessen Posten beworben. Die Chancen für eine Beförderung standen gut, denn die erfolgreiche Aufklärung der Binder-Morde hatte ihm immerhin eine offizielle Belobigung eingebracht. Die dienstliche Beurteilung, die letzte, die sein Freund „Gsteckei“ Häusl für ihn verfasst hatte, war ausgezeichnet gewesen. Und außerdem hatte er neun Monate lang kommissarisch die Dienststelle geleitet, was gar nicht so einfach gewesen war. Mit einem Bleistift in den klammen Fingern riss er nun den Brief auf und starrte auf den Briefbogen. Der Kaffee wurde kalt.