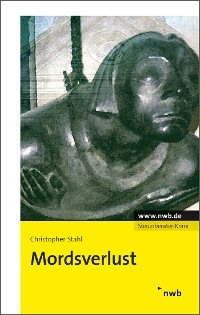Czytaj książkę: «Mordsverlust»
| © | NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne |
| Alle Rechte vorbehalten. | |
| Dieses Buch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahmen der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages unzulässig. | |
Zum Buch:
Renate Dohne ist spurlos verschwunden. Nach ihrer Ausbildung bei Darius Schäfer hat sie sich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden, dann aber den Polizeidienst kurz nach ihrer Hochzeit quittiert. Jetzt ist sie offenbar aus einer unglücklichen Ehe geflohen. Aber warum meldet sie sich nicht einmal bei ihrer Mutter? Hat ihr Verschwinden vielleicht doch etwas mit ihren früheren Recherchen bei der SoKo Rheinhessennetz zu tun? Hat die Vergangenheit sie eingeholt und in den Sumpf aus Wirtschaftskriminalität, Erpressung und Drogenhandel gezogen? Oder sollten Darius Schäfer und Kriminalhauptkommissar Heribert Koman doch einer ganz anderen Spur folgen? Denn schnell wird dem Steuerberater mit Spürsinn klar, dass die Winzerdynastie Preuß & Erben, in die Renate eingeheiratet hat, so manches Familiengeheimnis hütet. Gerade als Darius Schäfer meint, in einer Sackgasse zu stecken, kommt es zu einem Wiedersehen mit Renate Dohne, das er sich ganz anders vorgestellt hat …
Eine besondere Rolle spielt in diesem Fall ausgerechnet eine Plastik, die als Mahnmal für die Toten geschaffen wurde: Der Schwebende von Ernst Barlach, 1927, Bronze, Dom zu Güstrow.
Zum Autor:
Hinter dem Pseudonym Christopher Stahl verbirgt sich der renommierte Autor von Praktiker-Literatur für Steuerberater Gerd Jürgen Merz. Er lebt mit seiner Familie in Rheinhessen. Nach Tödliche Veranlagung, Schwarzes Geld für schwarze Schafe und Mörderische Bilanz ist Mordsverlust bereits sein vierter Darius-Schäfer-Krimi.
Der Schauplatz: Die Rheinhessische Schweiz
Das Gebiet zwischen Bingen, Mainz, Worms und Alzey wurde 1816 der Provinz Hessen zugeschlagen; später gehörte es zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Seinen heutigen Namen Rheinhessen erhielt es 1819. Im Rahmen der Länderneuregelung wurde es nach dem 2. Weltkrieg Rheinland-Pfalz angegliedert.
Es ist das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Deutschlands. Seine vielfältigen Produkte (Müller-Thurgau, Kerner, Scheurebe, Faber, Bacchus, Huxelrebe, Chardonnay, Silvaner, Riesling, Morio Muskat, Weißburgunder, Grauburgunder Pinot Gricio, Portugieser, Dornfelder, Blauer Spätburgunder, Gewürztraminer), werden in der ganzen Welt geschätzt.
Dem Teil Rheinhessens, das nördlich an das Pfälzische Bergland anschließt, hat man wegen seiner hügeligen Landschaft den bezeichnenden Namen Rheinhessische Schweiz gegeben.
Hier, in dem Weindörfchen Bernheim und der näheren Umgebung, beginnt und endet diese Geschichte. Die örtlichen und geschichtlichen Gegebenheiten orientieren sich an der Realität. Nur das Dörfchen Bernheim, das gibt es ebenso wenig wie die handelnden Personen. Sie und ihre Geschichte sind Produkte der dichterischen Freiheit. Sie sind so frei gestaltet, wie halt eben die Fantasie doch unwillkürlich und ohne Absicht durch die persönliche Lebenserfahrung gesteuert wird.
Entscheidende Personen, die uns immer wieder begegnen und ohne die unsere Geschichte nicht „leben” würde.


Das Wort Familienbande
hat einen Beigeschmack von Wahrheit.
(Karl Kraus)
Montag, 4. April 2005
„Wo ist dein Problem, Darius?” Heinz stellte sein halbvolles Weinglas auf dem Tresen ab, an dem wir seit einer guten Stunde im Bernheimer Schafbock standen.
Es war einer dieser tristen, nasskalten Tage, an denen man schon absonderlich veranlagt sein musste, um nicht wenigstens einen Anflug von Trübseligkeit zu verspüren. Einer dieser Tage, an denen man den Eindruck haben konnte, das noch junge Jahr stecke mitten in der Pubertät und sei hin und her gerissen, für welche Jahreszeit es sich nun entscheiden solle.
Ich war einfach unzufrieden – mit mir selbst – und die verdrießliche Stimmung die der Tag vor dem Bürofenster verbreitet hatte, war nicht unbedingt dazu angetan, meine eigene aufzuhellen. Dazu war noch Wochenanfang und Sonja hatte sich heute Morgen von mir mit dem Hinweis verabschiedet, dass es wieder einmal spät werden könne und ich nicht auf sie warten solle. „Elternabend”, war ihre lapidare Erklärung, die sie mit einem bedauernden Achselzucken und einem nachgeschobenen Kuss auf meine Wange abzumildern versuchte. Und danach wollte sie sich noch mit ein paar Kollegen beim Lehrer-Lieblings-Griechen in Alzey treffen. „Soziale Pflichtübung” nannte sie das.
Ich konnte Beatrice, meine Ex-Frau, immer besser verstehen. Während der letzten Jahre unserer Ehe war sie es gewesen, die immer häufiger auf ein geregeltes und vertrauenswürdiges partnerschaftliches Zusammensein hatte verzichten müssen. Vor drei Jahren – lange nach unserer Scheidung – hatte ich begonnen, mein Leben umzukrempeln und als Konsequenz meine Steuerberatungskanzlei verkauft, an Carlo Dornhagen, einen ehemaligen Betriebsprüfer beim Finanzamt Alzey. Die Übergabe war mit meiner festen, sogar vertraglich vereinbarten Absicht verbunden, dort nur noch mit halber Fahrt mitzuarbeiten.
Doch wenn mich nicht eine Serie von Schicksalsfügungen immer wieder einmal für mehrere Wochen in die Gefilde der Hobbykriminalistik entführt hätte, wäre ich schon bald gedankenlos in den alten Trott zurückgefallen. Obwohl ich für mich die Feststellung getroffen hatte, dass Trott nicht allzu weit entfernt war von Trottel. „Lieber ein Löwe am Abgrund, als ein Esel vor dem Karren.” Wie oft und mit welcher Überheblichkeit, hatte ich nach meinem Erwachen aus einem jahrelangen beruflichen Albtraum anfänglich mit diesem Spruch auf andere eingeschlagen, die meine Veränderung nicht nachvollziehen konnten. Und dann, schleichend und kaum von mir bemerkt, verfiel ich wieder in alte Verhaltensmuster. Dass das Kanzleigebäude in dem umgebauten Kelterhaus eines kleinen, ehemaligen Weingutes untergebracht war – nur zehn Schritte von dem Haus entfernt, in dem ich mit Sonja, zwei Hunden und drei Katzen lebte – wirkte sich begünstigend auf meine Rückfälle aus.
Das Anwesen lag am Ortsrand von Bernheim, einem kleinen Winzerdorf in der Rheinhessischen Schweiz. Die Region hatte immer als Garant für die ideale Witterung zum Weinanbau gegolten, während der letzten Wochen allerdings schien diese Auszeichnung nicht mehr zuzutreffen.
Da saß ich also an meinem Schreibtisch, stapelte lustlos Akten von einer auf die andere Seite, verteilte einiges in Hängehefter, suchte nach irgendetwas im Internet und wusste, dass etwas geschehen musste. Aber was?! Sonja nicht da, mieses Wetter und matschige Wege, die einem das Joggen verleideten, Unzufriedenheit mit meiner eigenen Inkonsequenz – was half da? Ein gutes Männergespräch mit Heinz, unterstützt von ein paar Bernheimer Roten.
Heinz Runde, ein begnadeter Softwarespezialist und bekennender und praktizierender Demeter-Ökologie-Nebenerwerbslandwirt, gehörte mit seiner Frau Karin zu meinen engsten Freunden. Beatrice hatte beide ursprünglich als eine Art Mitgift in unsere Ehe eingebracht und mir nach der Scheidung anteilig zum weiteren Nießbrauch überlassen.
Ich griff spontan zum Telefon.
„Wir treffen uns im Schafbock, um acht, ich muss zuerst noch die Tiere füttern”, war seine prompte Reaktion auf meine Bitte, ein Gläschen mit mir zu trinken. Er war einer meiner Mandanten, aber er kam auch zu mir, wenn er ein Problem abseits steuerrechtlicher Belange hatte. Und ich konnte ebenso auf ihn zählen.
Wir standen am Tresen in unserer Dorfgaststätte. Die Werbeuhr der Kirner Brauerei an der Wand zeigte kurz vor halb zehn. Obwohl sich die Kochkünste von Paul Herbst, der seit fast zwei Jahren das Lokal führte, inzwischen rumgesprochen hatten und Gäste aus der gesamten Umgebung anlockten, waren die Tische heute kaum besetzt. Kein Wunder – es war Montag, der Teuro verleidete den Leuten weiterhin das Ausgehen und das dritte deutsche Wirtschaftswunder hatte sich immer noch nicht herbeireden lassen.
Am Tresen waren Heinz und ich alleine. So konnte ich meinen Frust loslassen, ohne dass ich auf unerwünschte Zuhörer hätte achten müssen. Maitre Paul, wie wir ihn anerkennend nannten, stand wie immer, wenn es in der Küche nichts zu tun gab, auf der anderen Seite des Ausschanks. Angetan mit seiner burgunderroten Schürze, mit dem eingestickten goldfarben und ineinander verschlungenen Namenskürzel PH, wartete er in diskretem Abstand im Hintergrund auf einen Wink, unsere Gläser mit Bernheimer Spätburgunder zu füllen. Jeder von uns hatte bereits fünf Striche auf seinem Deckel.
Nebeneinander stehend, unsere Rücken dem Gastraum zugewandt, mussten wir ein imposantes Bild abgeben. Von hinten sahen wir uns, soweit es unsere Statur betraf, zum Verwechseln ähnlich. Heinz war mit 1 Meter 85 nur knapp größer als ich. Von vorne betrachtet erkannte man natürlich den Unterschied von zehn Jahren, die ich Heinz voraus hatte. Er war in seinem Farmerlook – kariertes Hemd und speckige Glattlederhose – ich immer noch im anthrazitfarbenen Kanzleianzug, was darauf hinwies, dass ich Sonjas Abwesenheit zu Überstunden missbraucht hatte. Den Schlips hatte ich allerdings abgelegt.
Einen Fuß auf der Trittstange abgestellt, leicht nach vorn über den Tresentisch gebeugt hielten wir unsere Gläser in der Rechten und starrten in das dunkle, satte Rubinrot. Ich hatte mich ausgequatscht, Heinz hatte zugehört und nun konnten wir … schweigen. Eine Szene wie in einer alten Westernschnulze. Ich schmunzelte vergnügt vor mich hin, mir ging es besser, Heinz hatte mich verstanden. Oder etwa doch nicht?
„Wo ist dein Problem, Darius?” Er stellte sein halbvolles Glas auf dem Tresen ab. „Gut, Beatrice hat dich vor acht Jahren mit euren beiden Söhnen verlassen. Aber, die sind ohnehin schon längst aus dem Haus und mit Beatrice besteht eine Freundschaft, die anscheinend besser funktioniert als eure Ehe.”
„Schon, aber …”
„Und seit fast drei Jahren bist du mit Sonja zusammen. Ihr passt zusammen, ergänzt euch und seid offenbar glücklich.”
„Ja, das stimmt ja alles, aber …”
„Was denn aber. Dir könnte es doch nicht besser gehen. Wie kann man nur so wehleidig sein, nur weil mal nicht alles so geht, wie man es sich vorstellt. Du könntest wirklich etwas entspannter sein.”
„Du musst gerade reden. Wie war das denn letzten Monat, als ihr Oskar geschlachtet habt, weil trotz mehrmaliger Deckungsversuche keine eurer Kühe trächtig wurde.” Heinz winkte ab, aber ich wollte einfach zeigen, dass auch er seine Grenzen hatte. „Und kurz danach habt ihr festgestellt, dass er doch seiner Bullenpflicht erfolgreich nachgekommen war. Der wollte nur nicht, dass ihr dabei zuseht. Nur war da der verhätschelte Zuchtbulle schon im Topf.”
„Klar hat mich das geärgert.”
„Geärgert? Tagelang gab es kein anderes Thema. Ganz Bernheim musste an deinem Kummer teilnehmen. Und als der Metzger dann wegen eines Missverständnisses fast das ganze Fleisch zur Wurst verarbeitet hat, sogar die Filetstücke, da bist du gänzlich ausgeflippt. Dabei ist es doch nur dein Hobby und soll der Entspannung dienen.”
Beide hatten wir unsere Gläser geleert und ich erweckte Paul aus seiner Erstarrung. „Noch mal dasselbe” forderte ich und tippte mit dem Zeigefinger auf meinen Deckel. Ich hatte Heinz attackiert, dafür gab ich einen aus.
Als wir mit den Gläsern anstießen, kam ihm die Erleuchtung: „Weißt du, was dir fehlt? Du müsstest wieder einmal über eine Leiche stolpern. Kriminalabstinenz führt bei dir zu Entzugserscheinungen.”
„Abgesehen davon, dass deine Bemerkung nur knapp an der Grenze zur Geschmacklosigkeit vorbeischrammt, schreibe ich deinen Mangel an Einfallsreichtum übermäßiger Alkoholzufuhr zu.”
Er zählte demonstrativ die Striche auf seinem Zettel und tippte sich dann an die Stirn.
Doch ich fuhr ungerührt fort: „Falls du es übersehen haben solltest: Ich habe bisher nur dann den Privatermittler gespielt, wenn ich persönlich auf irgendeine Weise betroffen war. Horst war mein Freund und Peter Simonis und Conrad Hauprich waren Kollegen. Wenn überhaupt, würde ich mich nur dann reaktivieren lassen, wenn es wieder um jemanden aus meinem persönlichen Umfeld ginge – um dich zum Beispiel.” Ich übersah sein theatralisches Entsetzen. „Nein Heinz, mir geht es um etwas ganz anderes, etwas Existenzielles: Ich will nicht wieder in mein altes Leben abdriften, darum geht es mir!”
„Nun, dann habe ich mit meinem Gedankenflug doch Recht – oder? Es muss ja nicht immer ein Mord sein. Eine kleine Entführung oder eine saftige Erpressung oder ein bisschen Wirtschaftskriminalität würde ja auch schon genügen. Warte nur ab, der nächste Fall kommt bestimmt. Vielleicht schon morgen”, frotzelte er und klopfte mir jovial auf die Schulter. „Auf mich brauchst du als Opfer allerdings nicht zu hoffen. So leicht werde ich es dir nicht machen. Und bei dem guten Berater, den ich habe, ist ja noch nicht einmal das kleinste bisschen Steuerhinterziehung drin.”
Ich besann mich wieder auf männliches … Schweigen und Heinz schloss sich freundschaftlich an.
Aber schon wenige Tage später fühlte ich mich bemüßigt ihn zu fragen, ob er etwa heimlich einen Volkshochschulkurs in Hellseherei absolviert hatte, mit Bestnote.
Mittwoch, 6. April 2005
Ich hatte mit Sonja ausgiebig gefrühstückt und mich dann um meine Katzen und Hunde gekümmert. Nach intensiver Zeitungslektüre und noch ein wenig Rumtrödeln kam ich gegen zehn Uhr dreißig in die Kanzlei. Ich ging an der verwaisten Zentrale vorbei in mein Büro, wo ich die Tür hinter mir zuzog. Das war seit Jahren ein Zeichen für alle Mitarbeiter, dass ich weder persönlich noch telefonisch gestört werden wollte.
Mein Blick fiel von der immer noch trüben Aussicht vor dem Fenster auf meinen ebenso deprimierenden Schreibtisch. Im Laufe des Vormittags hatte sich erneut ein bedrohlicher Papierdschungel ausgebreitet. Und wieder einmal schaffte ich Ordnung, indem ich mich bemühte, zuerst einmal eine Bresche zu schlagen. Früher hatte das meine Sekretärin wenigstens in groben Zügen gemacht. Sie wusste, was dringend und was weniger wichtig war. Aber neben Telefondienst und am Empfang arbeitete Irene Dengler nur noch für den Übernehmer meiner Kanzlei, Carlo Dornhagen. Das war zwischen uns auch so vereinbart worden, dennoch vermisste ich ihre jahrelange Erfahrung und Übersicht.
Ich schaute auf meinen Terminplan, dann auf die Uhr. In einer halben Stunde stand eine Besprechung mit einem Mandanten, Karl Söhngen, an. Im Zuge der Übernahme eines alteingesessenen Handwerkbetriebs in Albig wollte er expandieren. Bisher war der Betrieb darauf ausgerichtet, Bauherren und Hausbesitzern genormte Fertigfenster von Drittlieferanten zu empfehlen und einzubauen. Der frisch gebackene Unternehmer, hatte vor, sich zusätzlich auf die Sanierung von denkmalgeschützten Häusern zu spezialisieren und Holzfenster nach individuellem Aufmaß zu fabrizieren. In Rheinhessen zeichnete sich seit einigen Jahren ein positiver Trend beim Umbau und bei der authentischen Renovierung alter Bauern- und Winzerhöfe ab. Söhngens Ansicht nach gab es dadurch einen wachsenden Bedarf an originalgetreuen Fenstern.
Bei meiner Beratung ging es um die Analyse der Machbarkeit seines Vorhabens, damit die Finanzierung günstig und sicher gestaltet werden konnte. Mehrere Stunden hatte ich mich sorgfältig auf die erbetene Beratung vorbereitet, recherchiert, gerechnet und anhand der ersten Zahlen ein sondierendes Bankgespräch geführt. Bis in die gestrigen Abendstunden hinein hatte ich noch ein Exposé vorbereitet, das inhaltlich und formal den banküblichen Anforderungen entsprach. Das wollte ich noch einmal kurz durchlesen, bevor ich es dem Mandanten vorlegte.
Kerstin Neubert, eine neue Mitarbeiterin, streckte den Kopf zur Tür herein und fragte leise: „Kann ich Sie kurz stören?”
„Worum geht es? Und zu flüstern brauchen sie auch nicht.”
„Frau Dengler ist ja seit gestern auf einem Fortbildungsseminar und hat mich gebeten, die Telefonate entgegenzunehmen.” Sie deutete auf das Funktelefon in ihrer Hand und sah mich erwartungsvoll an.
Sollte ich sie nun loben, weil sie es als neue Mitarbeiterin geschafft hatte, die Zentrale darauf weiterzuleiten oder was wollte sie? Ich blickte nervös auf die Uhr, dann auf das Exposé, das immer noch ungelesen vor mir lag, und schließlich zu ihr. „Schön. Und was wollen Sie mir damit andeuten?”
„Na ja, und sie hat gesagt, ich solle Sie nicht stören, wenn Sie Ihre Tür geschlossen haben. Und da sie gestern den ganzen Tag geschlossen war, habe ich Ihnen heute früh eine Telefonnotiz auf den Tisch gelegt.”
„Von wem, von wann?”
„Von Herrn Söhngen, gestern gegen siebzehn Uhr, kurz bevor ich gegangen bin, hat er angerufen. Und eben hat er …”
Ich winkte ab. Mir war keine Notiz aufgefallen und ich blätterte nochmals den Papierstapel durch, den ich flüchtig sortiert hatte. Tatsächlich, an der Büroklammer eines Schriftstückes verhakt, entdeckte ich eine rosafarbene Telefonnotiz. Bevor ich sie lesen konnte, klingelte das Funktelefon. Kerstin Neubert blickte mich unsicher an, ich nickte etwas ungehalten und sie nahm das Gespräch an. „Steuerberatung Dornhagen, Neubert? … Herrn Schäfer? Da muss ich mal sehen, Frau Faber.”
Das konnte nur Gertrud Faber sein, eine Kollegin. Ich nickte ein weiteres Mal und Frau Neubert stellte zu meinem Apparat durch. Während ich das Gespräch annahm, bedeutete ich ihr, noch zu bleiben. Sie nahm Platz.
„Hallo Gertrud”, begrüßte ich sie.
„Hallo Darius. Bitte entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe ein ernsthaftes Problem.” Ihre angenehme, warme Stimme klang gehetzt. Doch das kannte ich gar nicht anders von ihr. Gertrud – wir hatten uns bei der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung kennengelernt und sind seitdem per Du – war immer im Stress.
„Gertrud, du weißt, dass man ernsthafte Probleme nicht übers Knie brechen sollte. Ich habe in … fünf Minuten einen Mandantentermin. Das wird etwa eine Stunde dauern, danach …”, Kerstin Neubert wedelte mit der Hand und schüttelte den Kopf. Ich reagierte allerdings nicht darauf, da ich mir auf ihre Zeichensprache keinen Reim machen konnte, „…habe ich Zeit für dich. Ich rufe dann umgehend zurück.”
„Natürlich, sicher! Danke”, sagte Gertrud hastig und bat mich, sie unter ihrer Privatnummer anzurufen, weil sie nicht im Büro sei.
„Herr Söhngen hat den Termin abgesagt, das wollte ich Ihnen vorhin sagen. Und eben hat er …”
„Er hat abgesagt? Weshalb?”
Sie wies auf die Telefonnotiz, die ich immer noch in der Hand hielt. Ihr war zu entnehmen, dass der Finanzierungsberater der Commerzbank für heute um acht Uhr dreißig einen Termin mit ihm vereinbart hätte und er meine Beratung momentan nicht benötige. Ich blickte irritiert auf.
„Und bevor ich zu Ihnen kam, hat er noch mal angerufen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass mit der Bank alles geklärt sei.”
„Und, dass er mich nicht mehr benötigt!” Mein Sarkasmus war nicht zu überhören.
„So hat er es nicht gesagt. Aber Sie müssten ihn deshalb nicht zurückrufen, sagte er, weil er jetzt auch schon auf einer Baustelle ist. Ich soll Ihnen auch noch ausrichten, dass er sich für Ihre Bemühung bedankt.”
Ich war dem Platzen nahe und musste mich zusammenreißen; cholerische Chefs geben immer eine schlechte Figur ab. Dennoch wollte ich vorbeugen, damit ein solches Desaster nicht wieder vorkam.
„Ich hätte mir einige Arbeit sparen können, wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte”, erklärte ich.
„Ich bin das noch nicht gewohnt, zu entscheiden, wann ich durchstellen kann und wann nicht. Mein vorheriger Chef hat alle Telefonate selbst angenommen.” Sie kämpfte mit den Tränen, denn natürlich entging ihr meine Miene nicht, dabei galt mein Ärger weniger ihr als viel mehr den Kollegen, die immer noch ihre Mitarbeiter wie unselbständige Kinder behandelten.
„Ist schon gut, Frau Neubert. Aber wenn Frau Dengler wieder zurück ist, lassen Sie sich bitte von ihr einweisen, unter welchen Bedingungen Sie mich und auch Herrn Dornhagen sofort ansprechen können, auch wenn wir unsere Bürotüren geschlossen haben.”
Nun saß ich wieder alleine in meinem Büro und versuchte erfolglos, meinen Frustknoten zu lösen. Schließlich stürzte ich zu Carlo. Zum Glück war er alleine. Noch vor drei Jahren war er Außenprüfer im Finanzamt in Alzey, unserem weinseligen Kreisstädtchen, gewesen. Seine ruhige, faire und trotzdem integre Art seinem damaligen Dienstherrn gegenüber konnte ich über mehrere Jahre beobachten. Als es dann anstand, dass ich meine Kanzlei verkaufen wollte, war er der passende Kandidat. Ich musste meine Entscheidung für ihn noch keinen Tag bereuen. Inzwischen hatte er seine Steuerberaterprüfung abgelegt und … lebte mit Irene Dengler zusammen. Sie hatten schon lange ein Auge aufeinander geworfen.
Der kleine, leicht untersetzte Carlo saß hinter seinem Schreibtisch, strahlte mich an und wies mit einer einladenden Geste auf den Besucherstuhl davor.
„Was gibt‘s?”
Ohne Einleitung platzte ich los: „Zig Stunden Arbeit für die Katz. Natürlich hatte ich keinen separaten Vertrag für die Beratung gemacht, wer macht das schon bei langjährigen Klienten. Und jetzt geht der Söhngen ohne das Exposé und ohne mich zur Bank. Weißt du, was mich am meisten ärgert, weißt du das?”
Carlo fuhr sich durch das dichte, schwarze Haar. „Nö, aber du wirst es mir sagen.”
„Es geht mir weniger um das Honorar, das ich nun durch den Kamin jagen kann. Nein, ich habe mich zum Affen gemacht. Ich Trottel habe dem Finanzierungsfuzzi bei der CoBa, diesem Heinemann oder Heinzelmann oder wie der heißt, auch noch die Zahlen vorgelegt. Und der benutzt die gnadenlos, drückt meinem Mandanten eine Feld-Wald-und-Wiesen-Finanzierung aufs Auge, die sein EDV-Programm ausspuckt, und sahnt seine Provision ab. Und wer muss später mit dem Ergebnis umgehen, wenn Söhngen den Kapitaldienst nicht so erbringen kann wie geplant und wenn es an die steuerrechtliche Betrachtung geht? Wir doch. Und die Neubert ist nicht einmal in der Lage, zu entscheiden, wann …”
„Frau Neubert ist noch recht neu und du wusstest, in welcher Kanzlei sie gearbeitet hat, bevor sie zu uns gekommen ist. Da musst du dich nicht wundern.”
„Carlo, das ist nicht mehr der Beruf, den ich vor über 25 Jahren erlernt habe. Nicht genug, dass wir verantwortlich gemacht werden für die steuerlichen Bocksprünge aller bisherigen Regierungen, dass wir uns dauernd mit neuen EDV-Systemen rumschlagen müssen, die ein Schweinegeld kosten, und damit, dass die Mandanten immer unloyaler werden, von den Banken ganz zu schweigen, haben wir es verstärkt mit Mitarbeitern zu tun, die zu Fachidioten ausgebildet werden und denen die notwendige soziale Kompetenz fehlt. Nur nicht selbst denken.”
„Was willst du tun?”
„Ich mache diese ganze Scheiße nicht weiter mit. Ich habe heute Nacht lange mit Sonja geredet und dabei das Problem beim Namen genannt. Das heißt, Sonja hat es auf den Punkt gebracht:
‚Mach dir nichts vor, Darius‘, hat sie gesagt, ‚solange du den Stallgeruch deines Berufes in der Nase hast, wirst du immer weitermachen wie bisher.‘ Und dann sind wir zu der einzigen möglichen Lösung gekommen: Ende des Jahres werde ich ganz aus der Kanzlei aussteigen. Es ist mir klar geworden, dass es ein bisschen schwanger halt nicht gibt.”
Eigentlich hatte ich das Gespräch darüber in einer vorbereiteten Atmosphäre führen und Carlo nicht zwischen Tür und Angel damit konfrontieren wollen. Der Zorn jedoch hatte es rausgespült. Ich war dadurch ruhiger geworden und nun war ich gespannt auf seine Reaktion.
Er war aufgestanden, um den Tisch gegangen und hatte sich neben mich gestellt. „Steh einmal auf, Darius!”
Verdutzt über diese unerwartete Reaktion kam ich seiner ungewöhnlichen Aufforderung, ohne sie zu hinterfragen, nach. Er machte einen Schritt auf mich zu und umarmte mich. Dann schob er mich ein Stück von sich weg und sagte: „Bravo! Das ist genau die richtige Entscheidung, die war schon lange überfällig. Ich gratuliere dir.”
Ich musste ihn äußerst perplex angesehen haben.
„Heh, versteh mich nicht falsch. Ich freue mich nicht, dass du aufhörst. Ich freue mich für dich und Sonja. Ich habe dir viel zu verdanken und viel von dir gelernt Ich werde damit klarkommen müssen und auch klarkommen.”
„Na ja, wenn du dann einmal meine Hilfe benötigst …”
„Nein, mein Lieber. Das würde dir so passen. Kneifen gilt nicht!”, lachte er. „Wie hast du eben noch so schön gesagt? Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Oder wie wir hier sagen: Wasch mich, abber mach mer de Pelz nedd nass – dess geht hald nedd.”
Erleichtert ging ich zurück in mein Büro, um Gertrud Faber anzurufen. Wir waren im gleichen Alter. Ihr Mann war vor fast30 Jahren bei einem Unfall auf dem Weingut Preuß, hier in Bernheim, umgekommen. Er war mit der Ehefrau des Winzers wegen einer Inventaraufstellung im Weinkeller, als irgendeine Maschine explodierte und beide dabei tödlich verletzt wurden. Seitdem führte Gertrud die Kanzlei alleine. Ihre Tochter Renate hatte vor 15 Jahren ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei mir absolviert und war später zur Polizei gegangen – Kommissariat für Wirtschaftskriminalität. Sie war ein liebenswertes, hübsches und intelligentes Mädchen und Gertruds Ein und Alles. Vor fünf Jahren hatte sie den Enkel der Frau, die mit ihrem Vater umgekommen war, geheiratet; jetzt hieß sie Renate Dohne. Nicht nur das Mandat, sondern vor allem das gemeinsame Schicksal hatte die Familien enger zusammengeführt.
Gertrud hatte mir irgendwann einmal erzählt, dass Renate inzwischen ihren Dienst bei der Polizei quittiert hatte, da sie auf dem florierenden Weingut jede Hand benötigten. Sie kümmerte sich um die Buchhaltung.
Ich wählte Gertrud Fabers Privatnummer. Das Gefühl, dass mir plötzlich ein Stein vom Herzen gefallen war, drückte sich in Heiterkeit aus, die ich gerne teilen wollte: „Na, Gertrud, meine Gute, was kann ich für dich tun?”
„Schön, dass du zurückrufst. Ich habe ein ganz besonderes Problem, mit dem ich nicht klarkomme.” Ihre Stimme klang bedrückt. Ich kannte das. Man wälzte berufliche Fragestellungen, verrannte sich und sah vor lauter rechtstheoretischen Bäumen den Wald der praktischen Umsetzung nicht mehr.
„Um was geht es? Umsatzsteuer? Einkommensteuer? Vorweggenommene Erbfolge? Betriebsübergabe? Abschreibungen? Gesellschaftsrecht? Sprich dich aus! Manches Mal löst sich alles in Luft auf, in frische Luft.”
„Das aber nicht, Darius. Ich benötige keinen fachlichen Rat. Ich habe ein ganz anderes Problem. Es ist etwas passiert und ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll, weil du sie doch auch kennst.”
„Wen meinst du mit sie?”
„Renate. Sie ist verschwunden, seit einer Woche … spurlos.”