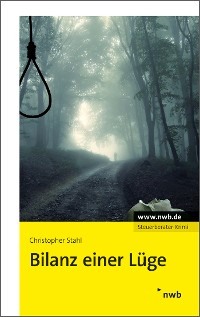Czytaj książkę: «Bilanz einer Lüge»
| © | NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne |
| Alle Rechte vorbehalten. | |
| Dieses Buch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahmen der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages unzulässig. | |
Zum Buch:
Gero Arnold, Druckereibesitzer und Sohn einer ehemaligen Mandantin, ist verzweifelt. Sein Unternehmen steht vor dem Ruin, weil Aufträge sabotiert werden und langjährige Kunden abspringen. Außerdem gehen anonyme Anzeigen wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit gegen ihn ein. Arnold ist sich sicher: Dahinter kann nur sein Konkurrent Dieter Knober, ebenfalls Druckereibesitzer in der Region, stecken.
Darius Schäfer ermittelt und gerät in ein Verwirrspiel aus brauner Gesinnung, mysteriösen Familiengeheimnissen und widersprüchlichen Indizien. Nichts scheint zueinander zu passen und auch privat verliert Schäfer den Boden unter den Füßen. Dann gibt es einen Toten – war es Selbstmord oder Mord? Darius beginnt, die Puzzleteile dieses Falles zu einem stimmigen Bild zu kombinieren, wobei auch seine eigene Geschichte eine entscheidende Wendung erfährt.
Zum Autor:
Gerd Jürgen Merz ist ein renommierter Autor von Praktiker-Literatur für Steuerberater und lebt mit seiner Familie in Rheinhessen. Unter dem Pseudonym Christopher Stahl möchte er mit seinen Darius-Schäfer-Krimis zu einem zutreffenden Image des Berufsstandes beitragen. Aber auch die Lust darauf, seine Heimat Rheinhessen zu entdecken, soll geweckt werden. Dort lässt er auch den sympathischen Steuerberater Darius Schäfer nun schon zum fünften Mal in Bilanz einer Lüge ermitteln.
Im NWB Verlag sind außerdem die Steuerberater-Krimis Tödliche Veranlagung, Schwarzes Geld für schwarze Schafe, Mörderische Bilanz und Mordsverlust erschienen.
Der Schauplatz: Die Rheinhessische Schweiz
Das Gebiet zwischen Bingen, Mainz, Worms und Alzey erhielt 1819 seinen heutigen Namen: Rheinhessen. Im Rahmen der Länderneuregelung wurde es nach dem 2. Weltkrieg Rheinland-Pfalz angegliedert. Es ist das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Deutschlands.
Dem Teil Rheinhessens, der nördlich an das Pfälzische Bergland anschließt, hat man wegen seiner hügeligen Landschaft den bezeichnenden Namen Rheinhessische Schweiz gegeben.
Hier, in der Verbandsgemeinde Wöllstein und der näheren Umgebung, spielt sich ein Großteil der Handlungen dieses Krimis ab. Die örtlichen und geschichtlichen Gegebenheiten orientieren sich weitgehend an der Realität. Nur das Dörfchen Bernheim und die Verbandsgemeinde Hunoldsheim gibt es ebenso wenig, wie die meisten der handelnden Personen. Lediglich die zu Beginn geschilderten Ereignisse der Kapitulation Friedbergs am 29. März 1945 und die in diesem Zusammenhang genannten Personen entsprechen belegten Tatsachen – bis auf den Soldaten Bernd Wegner. Er ist ebenfalls das Produkt literarischer Freiheit.
Einige der Personen, die uns immer wieder begegnen und ohne die unsere Geschichte nicht „leben” würde.

Die Lüge verbirgt ihre widerwärtige Fratze
hinter der Maske eines unschuldigen Kindes;
und dennoch gebiert sie Kinder und Kindeskinder ihresgleichen.
Entreißt man ihr die Maske,
erscheint nicht das Antlitz der Wahrheit,
klärend, entschuldigend,
sondern die Maskerade tritt in ein neues,
noch scheußlicheres Stadium,
gleich einer giftigen Schlange,
die sich den Gesetzen der Natur folgend häutet,
um doch stets dieselbe zu sein.
(Christopher Stahl)
Donnerstag, 29. März 1945, Friedberg/Hessen
Tiefblauer Himmel, strahlende Sonne und für die Jahreszeit ungewöhnliche 18 Grad zur Mittagszeit luden zu einem erholsamen Spaziergang ein. Die Natur hatte ihre eigenen Gesetze. Sie kümmerte sich nicht um das, was die Menschen sich an unfassbarem Grauen antaten. Es wirkte alles friedlich und doch war die Ruhe trügerisch. An diesem Tag nämlich bewegte sich die sechste US-Panzerdivision unter dem Befehl von Oberst Henry Hanson über die heutige Autobahn A5 von Grünberg in südlicher Richtung. Ihr Ziel war das circa 100 Kilometer entfernte Darmstadt. Auf ihrem Weg kreuzte sie Friedberg.
Das kleine Städtchen war bis 1943 vom Krieg verschont geblieben. Erst danach war es zu Luftangriffen gekommen. Als Drehscheibe für Truppentransporte und Lebensmittelversorgung war der Güterbahnhof Hauptangriffsziel der US-Bomber gewesen. Dem schwersten Angriff war die Stadt zwei Wochen vorher, am 12. März, schutzlos ausgeliefert gewesen. Für eine Abwehr war die Stadt nur kläglich ausgerüstet gewesen. Neben leichter Bewaffnung hatten nur ein paar Panzerfäuste und eine 4 cm Flakbatterie zur Verfügung gestanden, die von einer kleinen Einheit der Waffen-SS bedient worden war. Friedberg hätte insofern auch einem Bodenangriff nicht Stand halten können. Dass es jedoch bereits bei Eintreffen der Panzerdivision kapituliert hatte und seiner Bevölkerung ein ebenso verlustreicher wie aussichtsloser Widerstand erspart geblieben worden war, ist auf das beherzte Eingreifen des US-Majors Walter G. Smith und auf die mutige Unterstützung eines jungen Soldaten namens Bernd Wegner zurückzuführen.
Der 23-jährige Unterscharführer der Waffen-SS hatte an diesem Tag einen Brief mit der Feldpost erhalten, der ihn trotz der Besetzung Bad Kreuznachs durch die US-Armee aus dem Nahestädtchen erreichte. Es war ein Lebenszeichen seiner Verlobten. Im Oktober 1944 hatten sie sich das letzte Mal gesehen. Fünf Tage Heimaturlaub, nur für sie beide. Der schreckliche Krieg, die Not, das Sterben, das Schreien der Verwundeten, das Heulen der Sirenen – sie hatten es ausgeblendet. Ja, sie hatten sogar Zukunftspläne für die Zeit nach dem Krieg gemacht. Für die Zeit mit ihrem Kind. Im Gegensatz zu vielen anderen, die die Meinung vertraten, in eine solche Welt dürfe man keine Kinder setzen, waren sich beide sicher: „Unsere Zukunft liegt in unseren Kindern. Die haben die Chance, es besser zu machen als wir. Die werden niemals zulassen, dass so etwas noch einmal geschieht.” Und als sei es eine (bio)logische Konsequenz, hatte es das Schicksal so eingerichtet, dass Bernds Verlobte in diesem Oktober 1944 schwanger wurde.
Bernd wollte den Brief in angemessener Ruhe lesen. In der Stimmung, die in der Flakstellung am Stadtrand von Friedberg herrschte, wäre ihm das Lesen dieses Briefes wie ein Sakrileg vorgekommen. Verblendet von Durchhalte- und Endsiegparolen und benebelt durch die ständige Einnahme von Pervitin, fantasierten und halluzinierten sich seine Kameraden die Realität des verlorenen Krieges aus den Köpfen. Pathetisch zitierten sie Passagen aus Hitlers letzter Rundfunkrede am 30. Januar: „Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag”, hatte er verhießen, „sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotzdem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa – und an der Spitze jene Nation, die seit eineinhalbtausend Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird: Unser Großdeutsches Reich, die deutsche Nation!”
Bernd hatte inzwischen jeden Versuch einer Diskussion, die sich an den Tatsachen orientierte, aufgegeben. Er beteiligte sich auch nicht an den Saufgelagen. Die BDM-Mädchen und Flakhelferinnen, von denen einige glaubten, die Kampfkraft der Truppe durch freizügige Liebesdienste stärken zu müssen oder sogar noch Kanonenfutter für den Führer zu produzieren, waren für ihn tabu. Sein Kopf war klar, sein Verstand hellwach. Seinen Pervitin-Vorrat hatte er anseine Kameraden verteilt. Obwohl man ihnen allen die nationalsozialistische Ideologie in der gleichen Nationalpolitischen Lehranstalt, kurz NAPOLA genannt, eingebläut hatte, existierten die ehemaligen Bindeglieder nicht mehr. Im Gegensatz zu seinen Kameraden glaubte Bernd schon lange nicht mehr an das, was er einmal verherrlicht hatte. Dabei waren er und seine Eltern stolz darauf gewesen, als er 1938 im Alter von 16 Jahren die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden hatte. Arische Abstammung, so genannte Erbgesundheit und volle körperliche Leistungsfähigkeit waren die Grundvoraussetzungen gewesen, um überhaupt zugelassen zu werden. Bei der Aufnahmeprüfung hatte er zudem mühelos die geforderten Eigenschaften wie Mut, Durchhaltevermögen, Tapferkeit, Fähigkeit zur Einordnung, aber auch zur Übernahme von Führungsaufgaben, unter Beweis stellen können. Sein damaliger Jungmann-Gruppenführer, er war 12 Jahre älter als Bernd, hatte ihn unter seine Fittiche genommen. Schon früh der NSDAP beigetreten, waren Führer, Volk und Vaterland sein Universum. Er war das, was man einen Hundertprozentigen nannte. Ein Foto in seinem Spind dokumentierte, dass er Adolf Hitler schon persönlich begegnet und von diesem durch einen Handschlag geadelt worden war. Bernd Wegener hatte damals zu ihm aufgesehen – er war sein Idol.
Die einstige Jungmann-Gruppe der NAPOLA Oranienstein, in Dietz an der Lahn, blieb auch später als Flak-Einheit zusammen. Der Gruppenführer war inzwischen zum SS-Obersturmführer befördert worden und führte sie weiterhin.
Doch mittlerweile glaubte Bernd nicht mehr an die, die er einst glühend verehrt hatte. Und so war inzwischen das Selbstverständnis der gemeinsamen Gesinnung verlogenen Kameradschaftsfloskeln gewichen. Es entging ihm auch nicht, dass sie ihn mehr und mehr mit Skepsis beobachteten. Er ahnte, was sich in ihren verwirrten Köpfen abspielte: „Er wird doch nicht zum Vaterlandsverräter? Er wird doch nicht Fahnenflucht begehen?” Bernd konnte ihnen nicht mehr trauen. Vor allem nicht seinem ehemaligen Idol,seinem Gruppenführer. Dessen unerschütterlicher Glaube an den Führer und den Endsieg hatte inzwischen zwanghafte Züge angenommen. Dabei kamen die Schreckensmeldungen, die ihnen die Augen hätten öffnen müssen, doch auch in ihrer Stellung an. So hatte es am 27. Februar bei dem schwersten Luftangriff auf Bernds Heimatstadt Mainz 1.200 Tote gegeben und 33.000 Menschen waren obdachlos geworden. Die Sorge um seine Angehörigen bedrückte ihn mehr, als er es zeigen durfte. Mit wem sollte er darüber reden?
Am 2. März hatten amerikanische Einheiten das Sternenbanner auf der Porta Nigra in Trier gehisst. Vierzehnjährige Kinder hatten sich bei ihnen gemeldet. Man hatte sie zur Wehrmacht eingezogen. Mit Panzerabwehrkanonen ausgerüstet und zur Flak abkommandiert, hatten sie die Parolen vom Endsieg und Hitlers „Verbrannte Erde”-Befehl nachgeplappert. Sie hatten die Nachricht bejubelt, dass am 18. März Wehrmachtskommandos sämtliche Brücken im Raum Mainz-Wiesbaden gesprengt hatten.
Gestern war die Nachricht durchgesickert, dass sich die Amerikaner von Norden aus dem Raum Gießen kommend nach Süden fortbewegten – die Zange schloss sich. In der Nacht zuvor hatte sich auch noch eine Pionier-Einheit abgesetzt, die den Panzern Widerstand entgegensetzen sollte. Der leitende Kampfkommandant von Friedberg, Hauptmann Wölk, befand sich, wie er selbst gesagt hatte, „in völliger Unkenntnis über die Lage Friedbergs.”
In dieser Lage saß der Unterscharführer der Waffen-SS Bernd Wegner von der 17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen” auf einem Randstein am Ostrand von Friedberg. Er trug seinen Kampfanzug mit dem Tarnmuster. Neben sich hatte er den mit einem Tarnnetz versehenen Stahlhelm und seine Maschinenpistole MP 40 abgelegt. Bedächtig öffnete er den Umschlag, dessen Absenderadresse die seiner Eltern war. Hatte seine Verlobte etwa in Mainz Zuflucht gesucht? So unvernünftig wird sie doch nicht gewesen sein? Er entfaltete das mit Bleistift beschriebene Papier. Tränen hatten darauf ihre Spuren hinterlassen.
Mein Herzallerliebster,
ich weiß, daß Du Dir Sorgen um uns machst. Das mußt Du nicht. Für uns ist der schreckliche Krieg vorbei. Keine Angst mehr vor Spitzeln, keine Sirenen, keine Bombennächte mehr, in denen wir in den Radonstollen im Kauzenberg Zuflucht suchen. Die Amerikaner haben Bad Kreuznach eingenommen. Die Parteibonzen sind geflüchtet. Als erster Justus Heber von nebenan. Vorher hat er noch Uniform, Bilder und Abzeichen in seinem Garten hinter dem Haus verbrannt und vergraben. Ich habe das Fenster geöffnet und ihm zugerufen: „Das ist jetzt übrig geblieben von deinem 1000-jährigen Wahn. Dieser Aschhaufen.” Er hat mich nur blöde angesehen und ist dann verschwunden.
Ich sitze beim Schreiben dieses Briefes auf unserem Lieblingsplatz an der Nahe. Ruhig ist es und endlich friedlich. Unser Kleiner (oder unsere Kleine?) bewegt sich – ich soll Dich schön grüßen, heißt das. Doktor Brand ist zufrieden mit uns. Schade, daß meine Eltern das nicht mehr erleben können. Ich hoffe, daß Deine Eltern die Bombenangriffe überstanden haben. Falls dieser Brief Dich aus irgendwelchen Gründen nicht erreicht, soll er an Deine Eltern zurückgeschickt werden. Ich denke, daß die Postzustellung in Mainz eher funktioniert, als in Bad Kreuznach.
Ich wünsche so sehr und bete dafür, daß es auch für Dich bald vorbei ist und Du bei uns sein kannst. Halte durch, begib dich nicht mehr in Gefahr. Entschuldige, daß ich das so schreibe. Ich weiß, es ist naiv – aber wo kämen wir hin, ohne unsere Wunschträume.
Paß auf Dich auf, mein geliebter Bald-Ehemann. Wir warten auf Dich. Gott gebe, daß es nicht zu lange dauert. In Gedanken bin ich immer bei Dir – denke an unseren Stern. Wie eine Laterne soll er Dich überall hin begleiten und Dir den Weg zu uns leuchten.
Deine Dich über alles liebende Bald-Ehefrau.
Als ob er die Verfasserin damit streicheln würde, faltete er den Brief mit einer zärtlichen Bewegung wieder zusammen. Er führte ihn an seine Lippen und bildete sich ein, ihren lieblichen Duft in sich aufzunehmen. Dann schob er ihn in die linke Außentasche seines Kampfanzuges. Dabei bemerkte er das Flugblatt, welches er gestern heimlich eingesteckt hatte. Zu Tausenden waren sie abgeworfen worden, ohne dass die Einheit die geringste Chance gehabt hätte, das Flugzeug mit ihrer Flak auch nur zu irritieren. Er nahm es heraus und sah sich vorsichtig um. Weit und breit war niemand zu sehen. Die Aussage des Flugblattes war ebenso eindeutig wie glaubwürdig:

Auf der Rückseite des Flugblattes gab es detaillierte Anweisungen zur Übergabe. Selbst die anständige Behandlung der Kriegsgefangenen wurde in mehreren Punkten glaubwürdig und beruhigend ausgeführt. Sollte er nicht doch noch einmal versuchen, mitseinen Kameraden zu reden? Nein! Denen konnte und durfte er nicht mehr trauen. Er musste damit rechnen, dass sie ihn sofort festnehmen und den Kettenhunden vom Feldjägerkommando überstellen würden. Diese Einheit funktionierte nämlich, trotz – oder sogar wegen – zunehmender Auflösungserscheinungen immer noch mit erschreckender Zuverlässigkeit.
In seine Gedanken mischte sich plötzlich ein Geräusch, das er schon seit Tagen mit einer Mischung aus Angst und Freude erwartete: Das Gerassel schwerer, rollender Ketten und das Brummen starker Motoren – feindliche Panzer. Noch bevor er seinen Stahlhelm aufsetzen und die MP umhängen konnte, erschien ein Jeep, fuhr geradewegs auf ihn zu und stoppte vor ihm. Er war besetzt mit zwei Offizieren, beide lediglich mit einer Handfeuerwaffe ausgestattet. Ihre Helme hatten sie lässig ins Genick geschoben. Sie vermittelten den Anschein, als würden sie sich auf einer Ausflugsfahrt befinden.
Der Major auf dem Beifahrersitz sprang mit einem Satz aus dem Fahrzeug und rief: „Hey, I’m Major Smith of the sixth US-Division. In a few minutes onehundredeighteen tanks will be approaching Friedberg. Hondertaktzehn Panzer, du verstehn?”
So unspektakulär hatte sich Bernd seinen ersten direkten Kontakt mit den Amis und seine Gefangennahme nun wirklich nicht vorgestellt. Er war perplex. In einigen Minuten sollten 118 Panzer Friedberg erreichen? Er schluckte und räusperte sich, bevor er mit rauer Stimme antwortete: „Yes, of course, I understand.”
Dann sah er den Major fragend an. Was sollte er nun tun? Was erwartete der Amerikaner von ihm? Dass er die Arme hob? Oder sollte er mit dem eben gelesenen Flugblatt wedeln? An Widerstand, wie man es ihm und seinen Kameraden eingehämmert hatte, war jedenfalls überhaupt nicht zu denken. Einerseits war die Situation unerwartet friedlich. Andererseits lag seine Maschinenpistole immer noch außer Reichweite im Gras neben seinem Stahlhelm. Verdammt, der Stahlhelm. Es kursierte das Gerücht, dass die Amerikaner mit SS-Angehörigen kurzen Prozess machten,seit sie von den Gräueltaten aus befreiten Vernichtungslagern wussten. An seinem Kampfanzug hatte er zwar keinen Kragenspiegel mit den SS-Runen und auch am Ärmel wies der grüne Streifen lediglich auf seinen Dienstgrad hin. Seine Feldmütze mit dem Totenkopf-Emblem hatte er in der Flakstellung gelassen. Aber was, wenn sie die beiden Sig-Runen auf seinem Stahlhelm entdeckten? Noch lag der Helm im Gras, welches das Symbol verdeckte. Noch. Was, wenn sie die Tätowierung seiner Blutgruppe auf der Innenseite des linken Oberarms suchten und fanden?
Irritiert blickte er zu dem Fahrer, der lässig im Jeep saß. Der grinste ihn mit freundlichem Nicken und kaugummikauend an, bevor er sich dem Major zuwendete: „Why don´t we ask that guy? It seems he speaks English. He surely can do it.”
Bernd wunderte sich. Was sollte er sicherlich tun können?
Ohne eine Antwort abzuwarten, richtete der Fahrer sich nun an Bernd: „I`m Bob Tricky, First Lieutenant. What’s your name?”
„Wegner, Bernd Wegner. I am a sergeant in the….”
Major Smith unterbrach ihn: „We don´t care about your rank, young man. It doesn´t count any longer. We need your help to prevent bloodshed. Isn’t that what you want, too? Are you prepared to help us?”
Bernd sah ihn beunruhigt an. Er sollte ihnen helfen, Blutvergießen zu verhindern? Was erwarteten die beiden Amerikaner von ihm? „What do you expect me to do?”, fragte er mit unsicherer Stimme.
„Nothing that will taint your military honor. Do you know where we can find your commander?”
Weshalb wollten sie wissen, wo sein Hauptmann zu finden sei?
„Yes, in the castle, over there. You see the tower?” antwortete er mit einer plötzlichen Gelassenheit, über die er sich selbst wunderte. Er deutete in die Richtung, aus welcher der Adolfsturm über den Dächern Friedbergs zu sehen war. Er war stolz auf seine Sprachkenntnisse und dankte seinem Englischlehrer posthum, dass er ihn so gestriezt hatte.
„Okay, hop in!”
Bernd stieg in den Jeep und so fuhren die Amerikaner mit dem „feindlichen” Unterscharführer nach Friedberg hinein. Bernds Stahlhelm und die MP 40, aus der der Major das Magazin entfernt und in hohem Bogen in ein Gebüsch geworfen hatte, hatten sie achtlos in den Jeep gelegt. Bernd sollte ihnen den Weg zur Kampfkommandantur zeigen und dort als Dolmetscher fungieren. Als der Jeep, an dem der Major inzwischen ein weißes Tuch befestigt hatte, am Burgtor eintraf, wurde er bereits von Kampfkommandant Hauptmann Wölk erwartet. Sie stiegen aus. Bernd nahm automatisch seine MP 40 an sich, auch wenn sie ohne Magazin nutzlos schien. Seinen Stahlhelm ließ er auf dem Rücksitz des Jeeps liegen.
Smith forderte Hauptmann Wölk ohne Umschweife zur Kapitulation auf. Bernd übersetzte: „Herr Hauptmann, ich fordere Sie zur Kapitulation auf, damit uns und Ihnen Unannehmlichkeiten erspart bleiben!”
Wölk lehnte zunächst ab mit dem Hinweis auf die eindeutige Befehlslage, an deren Umsetzung er sich zu halten habe.
Major Smith reagierte schroff und ungehalten: „Listen, Herr Hauptmann, within the last two days our troops occupied …”
„Hören Sie, Herr Hauptmann, innerhalb der letzten zwei Tage haben unsere Truppen …”, Bernd wollte weiterhin übersetzen, aber Major Smith wehrte ihn mit einer heftigen Handbewegung und dem Hinweis „Your commander will understand for sure! He simply has to!” ab.
Er wandte sich dann wieder Hauptmann Wölk zu: „Again: Within the last two days our troops occupied Offenbach, Weilburg, Wetzlar, Gießen, Wiesbaden and Hanau. Tomorrow we will get to Frankfurt and Darmstadt – that´s for sure. And now again: Kapitulieren Sie, Sir. It’s on you to prevent Blutvergießen!”
Wölk war nicht der Typ, der unter sinnlosem Einsatz tausender Menschenleben die Stadt halten wollte und willigte daraufhin ein. Beide Seiten atmeten auf, die Spannung schien gelöst. Bevor sie jedoch die Übergabemodalitäten besprechen konnten, störte derplötzlich auftauchende SS-Hauptsturmführer Straube die beginnenden Verhandlungen. Aufgebracht drohte er den „Vaterlandsverräter” Wölk bei Kapitulation zu erschießen. Dabei verwies er – mit deutscher Gründlichkeit – auf eine Anweisung des Reichsverteidigungskommissars Sprenger vom 15. Februar 1945. Mit zitternder Stimme las er die für diesen Fall vorgesehene Anordnung vor:
„Ich gebe hiermit den Befehl, Wehrmachtsangehörige, die sich bei Annäherung des Feindes nicht verteidigen oder die Flucht ergreifen wollen, rücksichtslos mit der Waffe niederzuschießen oder wenn es angebracht ist, zur Abschreckung der Bevölkerung – mit dem Strang – hinzurichten.”
Bernd übersetzte leise, was Straube mit wutentbranntem Blick und der Bemerkung: „Halten Sie sofort das Maul! Wo eine Kugel für diesen Verräter ist, gibt es noch eine zweite für Sie!” quittierte. Dabei griff er nach dem Holster, um offensichtlich seine P 38 zu ziehen. Ohne lange zu überlegen, wirbelte Bernd seine Maschinenpistole herum, sodass er den Lauf in beiden Händen hielt und stieß dem Hauptsturmführer den Kolben gegen den Solarplexus.
Major Smith, der anfangs offensichtlich von dieser Szene belustigt war, richtete daraufhin seine Pistole auf den Störenfried, der zusammengekrümmt und mit schmerzverzerrtem Gesicht nach Luft rang. Gleichzeitig wurde Straube von First Lieutenant Tricky entwaffnet.
Auf Wölks Standhaftigkeit und Überredungskunst war es schließlich zurückzuführen, dass Hauptmann Straube die Aussichtslosigkeit der Lage einsah, der Kapitulation ebenfalls zustimmte und von Major Smith daraufhin die Erlaubnis erhielt, sich abzusetzen. Dennoch drohte er beim Hinausgehen, dass das noch ein Nachspiel haben werde und seine Kameraden sich um das Verräterschwein kümmern würden. Offensichtlich war Bernd der Adressat dieser Warnung, was Major Smith veranlasste, ihm einen Passierschein auszustellen, der ihn durch die amerikanisch besetzten Gebiete geleiten sollte.
„Welches Ziel soll ich eintragen?”, fragte er in fast akzentfreiem Deutsch, hob aber beide Hände, als Bernd ihn fragend ansah. „Nicht fragen.”
„Bad Kreuznach”, kam es wie aus der Pistole geschossen. Bernds Augen glänzten. Vor wenigen Stunden noch hatte er ihren Brief in den Händen gehalten. Was hatte sie geschrieben? „Ich wünsche so sehr und bete dafür, dass es auch für dich bald vorbei ist und du bei uns sein kannst. Halte durch, begib dich nicht mehr in Gefahr. Entschuldige, dass ich das so schreibe. Ich weiß, es ist naiv – aber wo kämen wir hin, ohne unsere Wunschträume.” Und wie schnell wurde sein Wunsch, nach Hause zu dürfen, nun Realität. Er meinte, das Herz müsse ihm zerspringen vor Glück. Er würde seine Liebste wieder sehen, sie endlich heiraten, bei der Geburt seines Kindes dabei sein, … keine Gefangenschaft, … hoffentlich lebten die Eltern noch!
Sein euphorischer Gedankenwirbel wurde von Hauptmann Wölks fürsorglich klingender Stimme unterbrochen: „Lass dir von der Burgverwalterin Zivilkleidung und Proviant geben, mein Junge”, empfahl er. „Und noch etwas: Nimm dir Zeit! Geh unseren Truppen aus dem Weg! Teilweise sind sie versprengt, befinden sich in Auflösung – trotzdem Vorsicht, sie sind traumatisiert! Andere Truppenteile wiederum leisten heftigen Widerstand. Wenn die oder die Kettenhunde dich erwischen, nutzt dir dein Passierschein gar nichts. Ganz im Gegenteil. Für die bist du ein Deserteur, ein Volksverräter – Ungeziefer, das man vertilgen muss. Du weißt, dass das der offizielle Sprachgebrauch ist, also pass auf! Ich wünsche dir viel Glück.”
„Wir auch!”, rief Major Smith ihm hinterher. Aber Bernd hörte es nicht mehr. Er war bereits auf dem Weg nach Hause.
Major Walter G. Smith schilderte den Auslöser dieses ungewöhnlichen Zusammentreffens später einmal in einem Interview: „Als ich mit First Lieutenant Tricky am Ostrand von Friedberg einen jungen deutschen Soldaten am Randstein sitzen sah, dachte ich, man könnte es ja probieren. Ich wusste eigentlich nicht, warum iches tat. Ich glaube ich war erpicht darauf – verstehen Sie – und wollte einmal sehen, wie es zuging, wenn ich eine ganze Stadt zur Übergabe aufforderte”.
Heute künden drei große Gedenktafeln auf dem Burggelände von den Ereignissen am 29. März 1945 in Friedberg. Als Erinnerung daran, dass an diesem Tag die Vernunft über den blinden Gehorsam siegte. Aber auch an die Helden dieses Tages. An Hauptmann Wölk, Major Smith und noch einige andere. Einen Namen sucht man allerdings vergebens auf diesen Tafeln: Bernd Wegner. So wie auch seine Verlobte vergeblich auf seine Heimkehr wartete. Sein Sohn, der am 12. Juni 1945 zur Welt kam, hat ihn nie kennen gelernt.