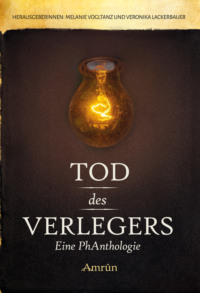Czytaj książkę: «Tod des Verlegers»
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Ticktock
1. Märchenhaft
Herzen und Mondsteine
Mr. Eldritchs Garten
Unter der Weltenesche
Spiegelwelten
Ein Stück vom Kuchen
Des Schicksals Gleichgewicht
Ticktock
2. Abenteuerlich
Ikarus
Architekten zukünftiger Vergangenheiten
Schlange und Rassel
Die Gegenwart der Zukunft
Schlüsselkind
Ticktock
3. Unheimlich
Grotens vun de Gongers
Heimsuchung
Betsy
Die Kunst ist tot ... (wieder mal)
Die Galenrooh Affare
Magie des Nordwinds
Ticktock
Abschiedsbrief
Biografien
Tod des Verlegers
Eine PhAnthologie
Melanie Vogltanz
Veronika Lackerbauer
(Hrsg.)
© 2020 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
Herausgeber: Melanie Vogltanz & Veronika Lackerbauer
Umschlaggestaltung: Christian Günther | Agentur tag eins
Alle Rechte vorbehalten
ISBN TB – 978-3-95869-140-7
Printed in the EU
Besuchen Sie unsere Webseite:
amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
v2/20
Ticktock
Melanie Vogltanz
Die Kurzgeschichte ist tot!
Mit diesen Worten hast du mich abgewiesen, als ich in der Stunde höchster Not zu dir kam und dich um deine Hilfe bat. Das ist ironisch, denn du irrst dich nicht nur, nein – du selbst wirst in naher Zukunft das Zeitliche segnen. Ich kann mir deine Reaktion auf diese Mitteilung lebhaft vorstellen. Wahrscheinlich starrst du gerade ungläubig auf diese Zeilen, deine Nasenflügel vor Zorn bebend, der Mund verkniffen wie nach dem Biss in eine Zitrone. Du bist wütend, nicht besorgt, denn Wut ist immer deine erste Reaktion auf alles, was du nicht verstehst.
Jetzt lachst du wahrscheinlich, peinlich berührt, wie leicht du zu durchschauen bist. Außerdem hoffst du immer noch auf einen Scherz. Tut mir leid, meine Liebe, aber ich muss dich enttäuschen. Die Angelegenheit ist bitterernst. Dass die Tür nach deinem Eintreten ins Schloss gefallen ist, war kein Zufall und auch kein Windstoß, und dass du sie nicht wieder öffnen kannst, liegt nicht daran, dass der altersschwache Türrahmen verzogen ist. Du bist hier unten gefangen, meine Liebe, und wenn du jetzt nicht deinen Hochmut hintanstellst und aufmerksam aufpasst, wirst du hier unten dein Ende finden.
Bestimmt willst du dieses Blatt nun zornig in deiner Hand zerknüllen, es am liebsten zerreißen, aber glaube mir, das wäre keine gute Idee, denn dann bist du endgültig verloren. Wenn du allerdings die Nerven behältst, kannst du deine Haut vielleicht noch retten.
Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit?
Gut.
Hörst du dieses Ticken? Wahrscheinlich bemerkst du es erst jetzt, obwohl es bereits in der Sekunde eingesetzt hat, als die Tür hinter dir zugefallen ist. Es stammt von dem Kästchen, das auf dem Tisch vor dir steht. Diese ausgeklügelte Apparatur wurde mir von einem guten, überaus findigen Freund zur Verfügung gestellt, der sich auf mechanische Spielereien wie diese spezialisiert hat. Siehst du das Tastenfeld, das an der Seite befestigt ist? Das mit den gusseisernen Buchstaben, die aussehen, als hätte sie jemand in mühseliger Kleinarbeit von einer antiken Schreibmaschine gelöst? Das ist deine Rettung, meine Liebe. Das – und die Kartons mit den Geschichten, denen du wahrscheinlich bis jetzt keinerlei Beachtung geschenkt hast.
Es sind dieselben Geschichten, die du vor ein paar Wochen für tot erklärt und dich zu lesen geweigert hast. Geschichten, an denen mein Herz hängt. Geschichten, in die ich genug Vertrauen setze, um zu glauben, dass sie ein Leben retten können. In diesem Fall das deine, Schwester.
Manche dieser Geschichten wollen dich zum Nachdenken bringen, andere wollen dich ängstigen, und wieder andere wollen dich einfach nur unterhalten. So unterschiedlich sie auch sind, jede von ihnen enthält auch ein kleines Stück einer größeren Wahrheit. Du wirst bald begreifen, wie ich das meine.
Irgendwo in diesen Schachteln steckt der Code in die Freiheit. Allerdings werde ich dir natürlich nicht verraten in welcher. Du musst die Geschichten schon lesen, um das herauszufinden. Deine Aufgabe: Finde den Code und gib ihn in das Kästchen ein. Anschließend bist du frei und kannst dein Leben wie gewohnt weiterleben.
Aber lass dir besser nicht zu viel Zeit. Das Ticken des Apparats ist nicht ohne Bedeutung – es misst die Zeit, die dir bleibt, um die Lösung zu finden. Sobald sie abgelaufen ist, gibt es für dich hier keinen Weg mehr hinaus – dann bleibst du hier unten gefangen. Wie lange das dauern wird, behalte ich allerdings für mich, schließlich will ich nicht die Spannung vorwegnehmen.
Ticktockticktock, Schwester.
P.S.: Sollte wider Erwarten jemand anderes als Katja diese Botschaft gefunden haben, entschuldige ich mich aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten und hoffe, dass Ihr Lesevergnügen nicht von einem langsamen, qualvollen Tod überschattet wird.
Hochachtungsvoll,
Benjamin Schauer
Fassungslos lasse ich den Brief sinken. Sofort drehe ich mich um und rüttele an der Kellertür, die hinter mir zugefallen ist. Keine Chance – sie sitzt bombenfest. Als ich genauer hinsehe, entdecke ich am Boden eine Drachenschnur mit einer Öse. Der Faden führt zu der psychedelisch tickenden Apparatur, die mein Bruder in seinem Brief beschrieben hat. Wahrscheinlich war die Schnur im Rahmen eingespannt. Als ich die Tür geöffnet habe, muss sie sich gelöst und das tickende Ding in Gang gesetzt haben. Perfide! Was allerdings jetzt die Tür blockiert, kann ich nicht feststellen.
Was auch bedeutet, dass ich es nicht aus dem Weg räumen kann. Benjamin hat recht. Wie es aussieht, sitze ich vorerst hier fest.
Wieder wischt mein Blick über die Zeilen des Briefes in meiner Hand. Mir entfährt ein nervöses Lachen. »Das ist ein Scherz«, sage ich. »Natürlich ist es ein Scherz. Wenn auch ein ziemlich geschmackloser.«
Beunruhigt beäuge ich das Kästchen.
Ticktockticktock.
Aber nur mal angenommen, es wäre kein Scherz …
Könnte Benjamin mir tatsächlich ans Leder wollen? Gott weiß, dass wir uns nicht unter den besten Umständen getrennt haben. Aber das war doch nicht meine Schuld! Wenn er Kohle brauchte, pochte er auf Familienzusammenhalt und drückte auf die Tränendrüse, ansonsten bekam ich ihn überhaupt nicht zu Gesicht. Entweder er trieb sich auf irgendwelchen Messen für Literaturjunkies herum oder er schloss sich hier ein, in seinem unterirdischen Arbeitszimmer, begraben unter Geschichten und Büchern. Und es waren nicht einmal sinnvolle Bücher, mit denen ein Normalsterblicher etwas anfangen konnte, Lebensratgeber oder Rezepte, nein, es war Phantastik. Abgedrehtes Geschwurbel, geschrieben von abgedrehten Sonderlingen, die mit der Realität nicht zurechtkommen und sich lieber ihre eigene Welt zimmern, statt ihr tatsächliches Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich hätte es ja noch verstanden, hätte Benjamin diesen Stuss gelesen – jeder braucht irgendein Ventil, meines ist zum Beispiel Tennis –, aber das reichte meinem Bruder natürlich nicht. Nein, Benjamin hatte vor fünf Jahren das wenige Geld in die Hand genommen, das er von unseren Eltern geerbt hatte, und damit einen Verlag gegründet. Einen Verlag! Für Phantastik! Ich warnte ihn noch, dass er sein Geld genauso gut in den Thermomix hätte werfen können, aber hörte er auf mich? Natürlich nicht, hat er ja noch nie getan.
War ich überrascht, als er vor einem Monat vor meiner Tür stand und mich um ein Darlehen anbettelte? Nicht wirklich. Das Ausmaß meiner Überraschung war ebenso groß wie das meiner Freude über seinen Besuch – nicht existent. Er behauptete, dass er niemals gewagt hätte, sich an mich zu wenden, würde es sich nicht um eine absolute Notlage handeln: Sein Verlag sei bankrott, und Benjamin selbst schwerkrank. »Der Arzt gibt mir nur noch wenige Wochen«, sagte er. »Bevor ich gehe, möchte ich noch dieses eine Buch machen – ein ganz besonderes Buch mit ganz besonderen Geschichten. Aber wenn du mir nicht finanziell unter die Arme greifst, wird daraus nicht. Bitte, Katja – erfülle einem Sterbenden seinen letzten Wunsch. Ich habe die Geschichten mitgebracht. Wenn du sie liest, wirst du bestimmt verstehen, warum sie mir so wichtig sind.«
Was soll ich sagen? Ich habe ihn samt Manuskriptstapel vor die Tür gesetzt. Schön, ich gebe zu, das war kein feiner Zug, und ich bin auch nicht stolz darauf. Aber zu meiner Verteidigung: Ich wusste ja nicht, dass er die Sache mit der tödlichen Krankheit ernst meinte. Benjamin brachte andauernd solchen Mist – erfand Krankheiten, Räumungsaufforderungen oder Todfeinde, um seinen Willen durchzusetzen. Wahrheit war für ihn etwas, mit dem sich nur die Fantasielosen herumplagen mussten. Als ich ihn einmal mit seinen Lügengeschichten konfrontierte, da sagte er: »Ich lüge nicht, ich erzähle Geschichten.« Auf meine Frage, was der Unterschied sei, antwortete er: »Eine Lüge verfälscht die Tatsachen aus egoistischen Gründen. Eine Geschichte beleuchtet die Tatsachen aus einem anderen Blickwinkel, um eine tiefere Wahrheit aufzudecken.« Ja, solchen geschwurbelten Stuss konnte er von sich geben, ohne rot zu werden.
Aber dieses eine Mal hatte er keine Geschichte erzählt. Ein paar Wochen darauf wurde ich über seinen Tod benachrichtigt. Der metastasierende Darmkrebs hatte ihn dahingerafft. Ein wenig überkam mich bei dieser Nachricht dann doch ein Anflug von schlechtem Gewissen, aber mal ehrlich. Es war nicht meine Schuld! Wie in diesem Märchen über den Jungen, der immer »Wolf« schreit, hat Benjamin mich einmal zu oft belogen und dafür seine Strafe erhalten.
Verdammter Idiot.
Ticktockticktock.
Wieder wird mein Blick von dem Apparat angezogen. Bestimmt habe ich Benjamin mit meiner Abfuhr nicht glücklich gemacht. Aber würde er mir tatsächlich noch über den Tod hinaus grollen? Es ist ja nicht so, dass er sonderlich viel von seinem Racheakt hätte – keine Schadenfreude, keine Befriedigung. Aber wann hat Benjamin sich jemals logisch verhalten?
Ich beuge mich über das Kästchen. Nehme es in die Hand, neige es von einer Seite zur anderen. Das Ticken wird schneller. Hastig stelle ich es wieder an seinen Platz. Kommt es mir nur so vor oder ist etwas Kleines darin verrutscht, als ich es bewegt habe? Ich gehe davor in die Hocke. Schnuppere daran. Merke im nächsten Moment, wie lächerlich ich mich verhalte. Ich bin kein verdammter Bombenspürhund, und selbst wenn mein Geruchssinn besser wäre, was erwarte ich zu riechen? Den Code?
Ticktockticktock.
Verstohlen wische ich mir eine Schweißperle ab, die auf meiner Nasenspitze kitzelt.
Wenn Benjamin denkt, ich spiele sein krankes Spiel ohne Gegenwehr mit, hat er sich geschnitten. Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche. Es ist denkbar einfach, was ich nun tun muss: Ich werde die Nachlassverwalterin anrufen, ihr sagen, dass ich mich versehentlich im Keller eingesperrt habe und sie bitten, mir von außen zu öffnen. Kein Drama. Dass Benjamin diese simple Lösung nicht vorausgesehen hat, wundert mich nicht, er hat ja noch nie in der Gegenwart gelebt.
Mein Gesicht entgleist, als mein Blick auf das Display fällt. Kein Empfang, nicht einmal ein winziger Balken. Es ist wie in einem dieser miesen Filme, die ich manchmal spätnachts laufen lasse, wenn ich nicht einschlafen kann.
»Mistding«, zische ich meinem Handy zu, obwohl das Gerät eigentlich völlig unschuldig ist. Die wahren Übeltäter sind wohl die gut isolierten Kellerwände.
Vielleicht werfe ich doch mal einen Blick in die Kartons mit den Geschichten. Kann ja nicht schaden, richtig? Und wie es aussieht, werde ich hier sowieso nicht so bald rauskommen. Da kann ich mir eigentlich genauso gut was zum Lesen nehmen.
Es sind insgesamt drei Kartons, kaum größer als Schuhschachteln. Am Rand sind sie mit Benjamins fast unleserlicher Sauklaue beschriftet. Auf einer Schachtel steht »Märchenhaft«, auf einer »Abenteuerlich« und auf der letzten »Unheimlich«. »Märchenhaft« klingt am wenigsten anstrengend zu lesen, damit sollte ich wohl am schnellsten durch sein. Ich setze mich auf einen Stuhl, hebe die Schachtel auf meinen Schoß und nehme den Deckel ab. Zum Vorschein kommen mehrere Papierbündel, mit Heftklammern fein säuberlich zusammengehalten. Ich unterdrücke ein Seufzen, als ich beim Durchblättern die eng bedruckten Zeilen sehe. So viel Schrift!
Ticktockticktock.
Na gut, es hilft ja nichts. Vielleicht habe ich ja Glück und finde den Code schon in der ersten Geschichte. Oder wenigstens in der ersten Schachtel.
Ich will bereits mit dem ersten Bündel anfangen, da kommt mir eine brillante Idee. Bestimmt hat Benjamin diese Reihenfolge nicht ohne Grund ausgesucht; er will, dass ich das oberste Bündel als Erstes greife. Ich wette, es war sein Plan, dass ich so viele Geschichten wie möglich lese, bevor ich nach draußen gelange. Der Code ist also in einem der letzten Bündel – völlig logisch. Aber so leicht lasse ich mich von ihm nicht foppen!
Ich wühle mich in der Schachtel nach unten und zerre die Geschichte heraus, die auf dem Boden des Kartons liegt. Dass ich dabei einige Eselsohren produziere, verschafft mir eine grimmige Befriedigung.
Mit dem unheilvollen Ticken im Ohr fange ich an zu lesen.
Märchenhaft
1. Kiste
Herzen und
Mondsteine
Renée Engel
Neugierig drückte sie die Nase gegen das Fenster. Das spärliche Licht des Winternachmittags reichte nur wenige Meter in den Laden, vorbei an nahezu antiken Holzregalen rechts und links, in dem sich zerfledderte Bücher, alte Töpfe und Holzspielzeug stapelten.
Unsicher schob Marleen eine Strähne hinter das Ohr und trat ein paar Schritte zurück. Bestimmt war sie schon hundertmal an dieser schmalen Gasse vorbeigekommen, ohne sie zu beachten. Sie war so eng, dass der Übergang vom Bürgersteig zur Straße lediglich durch eine gemauerte Rinne markiert wurde, durch die das Regenwasser ablief. Kopfsteinpflaster machte den Boden uneben und das Gehen mühsam. Die ganze Straße wirkte dermaßen aus der Zeit gefallen, dass Marleen nicht mal über Gaslaternen als Beleuchtung überrascht gewesen wäre.
Ihr Blick kletterte die Fassade hinauf. Kleine Erker hier und da versperrten dem Licht den Weg, und stumpfe Fenster starrten blind auf die gegenüberliegende Hauswand. Kein Anwohner kontrollierte, wer sich in dieses abgelegene Viertel verirrt hatte, keine Gardine bewegte sich. Einzig die Briefkästen, die nicht überquollen, deuteten auf einen Rest von Leben.
Der Laden bot das gleiche, trostlose Bild. Der Zahn der Zeit hatte am Putz und einem Teil der Hausnummer genagt, und der verbliebene Rest war so dunkel, dass er mit der schmutzigen Fassade quasi verschmolz.
Ein letztes Mal suchten ihre Augen nach Hinweisen, ob sie wirklich an der richtigen Adresse stand. ALBERT NICOLAS MONDSTEIN, AN- UND VERKAUF, stand in grauen Lettern auf der vor Schmutz nahezu undurchsichtigen Scheibe. Der Name, der sie aus dem Albtraum, zu dem ihr Leben geworden war, befreien sollte.
Was ist jetzt? Reingehen oder verschwinden?, dachte sie.
Der Wind trieb ein paar tote Blätter vor sich her, vereinzelte Schneeflocken trudelten zu Boden. Ihre Fingernägel waren blau vor Kälte. Seit Tagen hatte sie das Gefühl, nie wieder warm zu werden. Genaugenommen seit dem Morgen, als der Arzt meinte, es gäbe für Patrick keine Hoffnung mehr.
Damals hatte sich dieser Eisklumpen in ihrem Herzen gebildet, der mit jedem einzelnen Tag, der ungenutzt verstrich, weiter wuchs. Wie lange war das her? Sechs Tage? Eine Woche?
Eine Ewigkeit, wenn man dabei war, das Liebste zu verlieren, was man auf der Welt besaß.
***
Sanft strich sie über die eingefallene Wange. Man konnte förmlich zusehen, wie der Krebs ihm das Fleisch von den Knochen nagte. Die Chemos trugen ihren Teil dazu bei, einen ehemals sportlichen jungen Mann in ein bleiches Wrack zu verwandeln.
So viel hatten sie noch vorgehabt: die Tauchtour am Great Barrier Reef, der Segeltörn die Westküste Australiens hoch. Seit dem Studium hatten sie davon geträumt – und jetzt das.
Marleen schluckte. Nein, es ging nicht um Australien. Es ging um Patrick. Ihren Patrick, der seit Monaten um sein Leben kämpfte. Was würde sie nicht alles tun, um …
»Frau Hoffmann?«
Marleen schrak zusammen. Die blonde Schwester legte Marleen behutsam die Hand auf die Schulter. »Die Visite kommt gleich.«
»Was? Oh ja, natürlich.« Zögernd stand sie auf. »Wissen Sie schon etwas von dem neuen Medikament? Doktor Kurz wollte sich mit einer Klinik in den USA in Verbindung setzen.«
Die Schwester sah sie aus großen, blauen Augen an. Das Namensschild mit der Aufschrift Schwester Susanne hob und senkte sich gleichmäßig auf ihrem ausladenden Busen.
»Ich darf Ihnen darüber keine Auskunft geben. Fragen Sie bitte Doktor Kurz. Nach der Visite hat er sicher Zeit für Sie. Sie können draußen warten. Im Aufenthaltsbereich gibt es einen Kaffeeautomaten.«
»Ich weiß«, schnappte Marleen. Sie hasste das mütterliche Getue der Schwester, die gedämpfte Stimme, das beruhigende Lächeln; sie hasste es, weil sie es verabscheute, nur herumzusitzen und nichts unternehmen zu können.
Ihre Schuhe quietschten auf dem gebohnerten Linoleum. Der Aufenthaltsbereich bestand aus einer Sitzgarnitur mit abwaschbaren Polstern, einem niedrigen Tisch, einem mannshohen Hydro-Ficus und dem Kaffeeautomaten. Bei gutem Wetter genoss gelegentlich ein Besucher die Aussicht in den angrenzenden Park, doch diesmal hatte Marleen den Bereich für sich.
Mit einem Kaffee Latte in der Hand setzte sie sich ans äußerste Ende des Sofas und starrte aus dem Fenster. Der Latte schmeckte wässrig, aber er war heiß. In den letzten Wochen hatte sie gelernt, für die kleinsten Annehmlichkeiten dankbar zu sein. Immerhin durfte sie hier sitzen und schlechten Kaffee trinken, während Patrick …
Ihre Sicht verschwamm. Trotzig wischte sie sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Fang bloß nicht an zu heulen!, schalt sie sich.
»Geht es um Ihren Mann?«
Auch das noch! Eine Dame um die achtzig hatte sich in einem Sessel niedergelassen und schaute sie über die aufgeschlagene Tageszeitung hinweg an.
Marleen nahm einen Schluck, um die Tränen runterzuspülen, und schüttelte den Kopf. »Mein Verlobter«, sagte sie schroff und wandte sich wieder ab. Es war ihr egal, ob die Frau sie für unhöflich hielt.
»Das tut mir leid. Sie sind noch so jung«, plapperte die Alte weiter.
Marleen verdrehte die Augen. Mitleid war das Letzte, was sie jetzt ertragen konnte. Noch dazu von einer wildfremden Frau. Sie stand auf.
»Wissen Sie, mein Mann – Herbert – ist vor drei Wochen gestorben. Auf dieser Station.«
Marleen erstarrte.
Zum ersten Mal sah sie die Frau direkt an. Sie war klein, krumm und unglaublich faltig. Doch in ihren blauen Augen funkelte ein Feuer, das angesichts ihres Verlustes überraschte.
»Herbert hätte schon vor sechs Jahren gehen sollen, aber ich habe dem Tod ein paar Jahre abgetrotzt.« Sie zwinkerte Marleen zu.
»Sie haben – was?«
»Dem Tod ein paar Jahre abgeschwatzt. Doch jetzt war seine Zeit eben abgelaufen. Das macht aber nichts. Ich werde ihm bald folgen.«
Sie plauderte in dem Ton, in dem sie auch vom Gewinn des ersten Preises für das beste Käsekuchenrezept auf einem Hausfrauenbasar hätte erzählen können. Dabei lächelte sie glücklich, als stünde ihr eine aufregende Reise bevor.
»Sie können ihm helfen, Ihrem Verlobten. Wenn Sie ihn lieben.«
Trotz des Kaffees brauchte Marleen einen Moment, um den Sinn dieser Worte zu erfassen. »Wie bitte?«
Die alte Dame schob die Anzeigenseite über den Tisch und deutete auf eine kleine Annonce rechts unten in der Ecke.
Albert Mondstein, An- und Verkauf
Verschwenden Sie keine Zeit, horten Sie sie!
»Das ist ein Scherz!«, sagte Marleen.
Die Alte schüttelte den Kopf. »Sechs weitere Jahre mit meinem Herbert. Das verdanke ich Mondstein.«
Marleen schob die Zeitung zurück. »Vielen Dank. Aber ich vertraue doch lieber den modernen Therapien«, sagte sie.
Die Frau schien nicht beleidigt. »Wie Sie wollen«, meinte sie. Dann riss sie vorsichtig die Anzeige aus dem Blatt und hielt sie Marleen hin.
»Stecken Sie das ein. Na los! Denken Sie in Ruhe darüber nach, und wenn Sie nicht überzeugt sind, schmeißen Sie sie weg.«
Marleen wollte wieder ablehnen, besann sich dann aber eines Besseren. Was konnte es schon schaden, der Frau den Fetzen abzunehmen? Wenn es sie glücklich machte? Sie stopfte die Anzeige in ihre Hosentasche und die Alte nickte zufrieden.
»Frau Hoffmann?«
Doktor Kurz war von seiner Visite zurück. Er gab Marleen die Hand. Sofort suchte sie in seinem Gesicht nach dem Funken Hoffnung, den er nach dem letzten Besuch in ihr selbst entfacht hatte.
»Gehen wir ein paar Schritte?«, fragte er.
Schon an seinem Ton erkannte Marleen, dass er keine guten Nachrichten hatte.
»Sie werden das Medikament nicht bekommen!«, kam sie ihm zuvor.
Er blieb stehen und musterte sie einen Moment, dann nickte er resigniert. »Es war unsere letzte Hoffnung; aber die Behörden machen uns einen Strich durch die Rechnung. Es tut mir leid.«
Marleen blies die Luft aus. Sie hatte nicht mal bemerkt, dass sie den Atem angehalten hatte.
»Das war‘s dann? Ich kann Patrick mit nach Hause nehmen – und ihm beim Sterben zusehen?«
Doktor Kurz setzte das Gesicht auf, das er vermutlich für trauernde Angehörige reserviert hatte. »Es gibt die Möglichkeit, ihn in ein Hospiz …«
Mit einer Geste schnitt ihm Marleen das Wort ab. »Nein! Vergessen Sie‘s. Patrick – er wird nicht sterben. Das werde ich nicht zulassen!«
»Aber Frau Hoffmann …«
Sie ließ ihn stehen und rannte beinahe den Flur hinunter.
Im Aufenthaltsbereich wischte eine Putzfrau zwischen den Sesseln.
»Hallo! Haben Sie die alte Dame gesehen, die eben noch hier saß?«, fragte Marleen aus einem Impuls heraus.
»Alte Dame? Ne. Ich habe gewartet, bis Sie weg waren, damit ich hier sauber machen kann. Von einer Dame hab ich nischt gesehen.«
Dann eben nicht, dachte Marleen und schaute in den Papierkorb. Sie war sicher, die alte Frau hatte die Zeitung in den Eimer geworfen.
»Haben Sie den Papierkorb geleert?«
»Na hör‘n Se mal. Ich hab gerade angefangen. Außerdem ist da doch eh nischt drin. Watt wollen Se denn?«
»Nichts. War nur eine Frage, danke.«
Sie tastete in den Hosentaschen nach der Anzeige, die die Frau ihr gegeben hatte. Das Papier knisterte beruhigend zwischen ihren Fingern.
Mein Leben bricht gerade auseinander und ich drehe komplett durch.
Sie wollte weg. Raus aus dem Krankenhaus, irgendwohin.
***
Eine kleine Glocke bimmelte aufgeregt, als sich die Tür öffnete, und noch einmal, als die Tür langsam wieder ins Schloss fiel.
Der Laden roch alt – wie eine Mischung aus feuchtem Keller und zugestelltem Dachboden, auf dem schon seit Jahren niemand mehr gewesen war. Sie wartete einen Moment, bis ihre Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, und auch darauf, dass jemand auftauchte, um sie in Empfang zu nehmen. Als nichts dergleichen geschah, wagte sie sich weiter vor.
»Hallo?«
Zögernd näherte sie sich dem altmodischen Verkaufstresen, die Dielen unter ihren Füßen knarrten protestierend. Um besser zu sehen, zog sie ihr Handy aus der Tasche und benutzte das Display als Taschenlampe. Der Strahl huschte über verblasstes Holzspielzeug, einen Globus und immer wieder Bücher, vom Alter gebeugt und zerfleddert. Porzellanpuppen mit aufgemalten Gesichtern glotzten sie vorwurfsvoll an, während sie von dem kalten LED-Licht geblendet wurde.
»Oh, verzeihen Sie, meine Liebe. Ich habe keinen Besuch erwartet.«
Die Stimme jagte ihr einen Schauer über den Rücken wie Fingernägel auf einer alten Schultafel.
Marleen fuhr herum. Vor ihr stand ein Mann unbestimmten Alters. Seine hagere, hochaufgeschossene Gestalt steckte in einem Morgenmantel oder Kaftan. Jedenfalls in einem Kleidungsstück, das vor ihrer Zeit modern gewesen war. In das schmale Gesicht hatte die Zeit tiefe Furchen gefräst. Man hätte es aristokratisch nennen können, wenn die lange Nase und die kaum vorhandenen Lippen den Gesamteindruck nicht gestört hätten.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte der Mann.
»Sind Sie Herr Mondstein?«
Er nickte. »Albert Nicolas Mondstein. Zu Ihren Diensten.«
Marleen räusperte sich. »Gut. Ähm, ich komme wegen der Anzeige.« Mit zitternden Fingern legte sie die zerknitterte Annonce auf den Tresen, wo sie unbeachtet liegen blieb.
»Das heißt, eigentlich komme ich wegen der Frau im Krankenhaus«, fuhr sie fort. Was redest du da?
Der Mann zog die Brauen hoch und schwieg.
Sie begann zu schwitzen. »Also, es geht um meinen Verlobten. Patrick. Er liegt im Sterben, weil«, sie räusperte sich erneut, »Krebs. Im Endstadium. Und da war diese Frau, die sagte, dass Sie mir helfen können. Sie hätten ihr auch geholfen, mit Herbert. Damit er weiterlebt, verstehen Sie? Jedenfalls würde ich alles tun, alles. Weil – ich ihn liebe«, schloss sie lahm.
Der Mann betrachtete sie stumm. Eine Minute, zwei, ihr halbes Leben? Sie hätte es nicht sagen können.
Plötzlich lächelte er. »Wie sehr lieben Sie Ihren Verlobten?«
»Mehr als mein Leben!«, antwortete Marleen, und sie fühlte tief in ihrem Inneren, dass es stimmte.
»Ausgezeichnet!« Herr Mondstein rieb sich die dünnen Finger. »Dann habe ich etwas für Sie.«
Er verschwand in einem Nebenraum und kehrte kurz darauf mit einer kleinen Schmuckdose zurück. Andächtig öffnete er das Kästchen und hob eine silberne Kette heraus, an der ein weißer, zu einem Herzen geschliffener glitzernder Kristall hing.
»Was ist das?«, fragte Marleen, gefangen von der Reinheit des Steins.
»Das, meine Liebe, ist ein Mondstein.«
»Ein Mondstein? Er heißt wie Sie?«
»Umgekehrt. Ich habe mich nach diesem Stein benannt, weil er ein überaus seltenes, kostbares Exemplar ist. Genau wie ich.«
Er lachte über seinen eigenen Witz, während Marleen sich mit Mühe ein Schmunzeln abrang.
»Und wie soll der helfen?«
Er schaute sie an wie ein begriffsstutziges Kind. »Ich könnte Ihnen was von Meteoriten auf ihrem einsamen Weg durch das Universum erzählen, und von Sternengeburten, aber das wäre profan. Stattdessen spreche ich von einem Stein, geformt aus den Tränen des Nordwinds, gehärtet in den Feuern des Polarlichts und von solcher Seltenheit, dass seine Existenz allein an ein Wunder grenzt. Dabei ist das noch nicht alles.«
Schweigend sah er Marleen an, die darauf wartete, dass er weitersprach.
»Auf seinem Weg durch die Mysterien des Weltalls hat er eine einzigartige Kraft gesammelt, die einen immer wieder staunen lässt: das Leben selbst.«
Marleen sah ihn irritiert an. »Ich verstehe nicht«, bekannte sie schließlich.
Er lächelte. »Dieser Kristall«, er hielt das Herz mit Daumen und Zeigefinger gegen das Licht, sodass die Strahlen darin funkelnde Regenbogen gebaren, »dieser Stein konserviert das Leben selbst. Er speichert Lebenskraft. Geben Sie mir Ihre Hand.«
Zögernd streckte Marleen ihre rechte Hand aus. Überraschend kräftig schlossen sich seine knochigen Finger um ihr Handgelenk.
Er legte den Kristall auf den Tresen, zog eine Schublade auf und zog eine lange Nadel hervor.
Marleen zuckte zurück, doch er hielt sie fest.
»He? Was … Au! Sind Sie verrückt geworden?«
Blut quoll aus einem Loch mitten in ihrem Handteller, doch Mondstein ließ die junge Frau nicht los.
»Sind Sie vollkommen übergeschnappt?«
Schweigend ließ der Alte den Stein in ihre Hand gleiten und schloss ihre Finger darüber zur Faust.
»Was …?«
Er legte den knochigen Zeigefinger auf seine Lippen. »Lassen Sie uns teilhaben an den Mysterien des Universums.«
Da das offenbar die einzige Antwort war, die er zu geben gedachte, blieb Marleen nichts übrig, als zu warten. Sie spürte das Herz in ihrer Handfläche. Es pulsierte warm, als wäre es lebendig. Ihre Handfläche pochte.
»Das dürfte reichen«, unterbrach er ihre Gedanken und ließ los.
Misstrauisch faltete Marleen die Finger auseinander und stieß einen kleinen Schrei aus. Ihre Handfläche war nicht blutverschmiert, wie sie erwartet hatte. Stattdessen leuchtete das Herz, das sie für einen einfachen Bergkristall gehalten hatte, in reinem, klarem Rubinrot. Der Alte nickte zufrieden.
»Das ist unmöglich. Ich meine, wo ist das Blut? Ist das ein Trick? Ich verstehe nicht …«
»Sie halten das für einen Trick? Ah ja! Sie denken an diese Metalle, die ihre Farbe je nach Temperatur ändern. Das ist Kinderkram! Dieser Stein jedoch«, wieder schloss er ihre Finger um den Anhänger, »dieser Stein hat Ihre Lebenskraft aufgenommen.«
Marleen öffnete den Mund, doch er hielt abwehrend die Hand in die Luft. »Nicht alle. Fünf Jahre, würde ich schätzen. Solange Ihr Verlobter diesen Stein trägt, wird Ihre Kraft, Ihre Lebensenergie, auf ihn übergehen. Fünf Jahre, die Sie Ihrem Patrick geschenkt haben, und die Sie kürzer leben werden.«
»Fünf Jahre, die ich ihm geschenkt habe«, flüsterte sie. Ungläubig strich sie über den Handteller, in dem die Wunde weder zu sehen noch zu fühlen war. Ein Stück Leben, das dir genommen wurde, raunte eine kleine, böse Stimme in ihren Gedanken. Sie schüttelte den Kopf, als müsste sie eine lästige Mücke verscheuchen.
»Also, der Kristall ist mit meinem Blut – meinem Leben? – rot geworden? Was, wenn ich ihn …?«
»Er wird dunkler, je länger Sie ihn in der Hand halten, ja. Und umgekehrt …« Er brach ab.