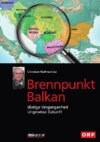Czytaj książkę: «Brennpunkt Ukraine»
Gewidmet meinen Töchtern
Immanuela und Michaela
sowie meiner Gattin Elisabeth.
Sie ließen mich in die Ukraine ziehen –
zu einer Zeit, als die Masse der
Journalisten die Befassung mit
diesem Land bestenfalls für ein
Rosenthema hielt.
Christian Wehrschütz
Brennpunkt
Ukraine
Gespräche über ein gespaltenes Land

INHALT
Cover
Widmung
Titel
Vorwort von Christian Wehrschütz
OHNE RUSSLAND WIRD ES KEINE STABILITÄT IN EUROPA GEBEN
Gespräch mit Ina Kirsch
DIE EINHEIT DER UKRAINE MUSS IN DER ERSTEN INSTANZ VON UKRAINERN SELBST GESCHAFFEN WERDEN
Gespräch mit Jack F. Matlock
DIESER MAIDAN WAR EINE REVOLUTION
Gespräch mit Leonid Krawtschuk
DIE UKRAINE GEHT IHREN WEG
Gespräch mit Pawlo Klimkin
ALLEIN MIT WAFFEN WERDEN WIR DEN KRIEG NICHT GEWINNEN
Gespräch mit Wiktor Juschtschenko
ICH GLAUBE DARAN, DASS DIE UKRAINE EIN STARKER STAAT SEIN WIRD
Gespräch mit Dmytro Firtasch
ES IST KLAR, DASS WIR NICHT WEITER ZUR UKRAINE GEHÖREN WEREN
Gespräch mit Boris Litwinow
WIR WERDEN BIS ZUM LETZTEN KÄMPFEN, NATÜRLICH
Gespräch mit Margarete Seidler
FÜR MICH SIND PUTIN UND JANUKOWITSCH EINFACH ZWEI VERBRECHER!
Gespräch mit Semen Sementschenko
FRÜHER ODER SPÄTER WIRD DAS EIN ANHÄNGSEL RUSSLANDS SEIN
Gespräch mit einer Bewohnerin von Donezk
TOLERANZ IST IN VIELEN FRAGEN EINFACH UNVERZICHTBAR
Gespräch mit Elisaweta Pliascheschnik
HIERGEBLIEBEN BIN NUR ICH, SONST KEINER
Gespräch mit Tatjana F. Ischtschuk
DAS GEFÜHL DER LEERE EINER AUSGESTORBENEN STADT
Gespräch mit Tatjana Malji
BRENNPUNKT UKRAINE
Chronologie der Ereignisse
Editorische Notiz · Bildnachweis
Weitere Bücher
Impressum
Klappentext
Fußnoten
VORWORT
von Christian Wehrschütz
Mit Fahrer Igor in Donezk

Liebe Leserin! Lieber Leser!
Dieses Buch ist das Ergebnis eines Kompromisses, den der Styria-Verlag und ich als Autor gefunden haben: Der Verlag wollte aufgrund der Aktualität des Themas noch im Herbst ein Buch über die Ukraine herausbringen. Ich selbst wollte die Veröffentlichung auf den Herbst kommenden Jahres verschieben, weil ich mich wegen der permanenten Berichterstattung für den ORF aus der Ukraine außer Stande sah, ein Buch zu schreiben, das in Form und Qualität den beiden Werken entspricht, die ich über den Balkan veröffentlicht habe. Außerdem lehne ich Schnellschüsse von Journalisten und Publizisten ab, die in eine Krisenregion kommen und dann ihre Erlebnisse in einer inhaltlich eher oberflächlichen Form auf den Markt bringen. Diese Gefahr besteht bei mir im Falle der Ukraine jedoch nicht, obwohl natürlich durch meine Tätigkeit als ORF-Korrespondent am Balkan zwischen meiner Rückkehr nach Kiew im Jänner 2014 und meinem bis dahin letzten Aufenthalt in der Ukraine eine Lücke von vierzehn Jahren klafft. Denn ganz habe ich dieses Land nie aus den Augen verloren, und ich habe mir auch in Belgrad die Kenntnisse der ukrainischen und der russischen Sprache bewahrt, die ich während meiner immer wieder wochenlangen Aufenthalte im Land zwischen April 1992 und Dezember 1998 erworben hatte. In der nunmehrigen Krisenregion Donezk absolvierte ich im Sommer 1992 meinen ersten Russischkurs im Ausland, in der Westukraine (u. a. Tschernowitz) war ich 1993 und 1994. Darüber hinaus erhielt ich vom Bundesheer im Sommer 1994 die Möglichkeit, in mehr als drei Monaten die Ausbildung zum Militärdolmetscher für Russisch und Ukrainisch abzuschließen, und absolvierte im Jahre 1996 an der österreichischen Botschaft in Kiew eine freiwillige Waffenübung in der Dauer von einem Monat als Mitarbeiter des Militärattachés. Schließlich nahm ich noch von Ende Juni bis Mitte August 1997 an der „Ukrainian Summer School“ an der renommierten Harvard Universität in den USA teil. Hinzu kamen viele Fachpublikationen über die Ukraine in den Jahren 1992 bis 1998 – gerade zu den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland sowie den Beziehungen beider Länder zu EU und NATO.
Ein besser auf die Ukraine und auf ein Buch vorbereiteter Journalist wird im deutschen Kulturraum nicht leicht zu finden sein. Aber auch diese Grundkenntnisse änderten nichts daran, dass ich mich zeitlich außer Stande sah, zwanzig Kapitel zu schreiben, um das Land in vielen Facetten zu beleuchten. Doch das Argument des Verlages wog schwer, dass die Ukraine jetzt aktuell sei und niemand wissen könne, wie groß das Interesse in einem Jahr sein werde. Die Berichterstattung in fast allen Medien leidet aus vielen Gründen an einem Mangel an Kontinuität; wie sehr haben Libyen und Ägypten noch vor ein, zwei Jahren dominiert, wie gering sind im Verhältnis dazu nun die Berichte über diese Länder. Der neue Krisenherd verdrängt den alten, weil Sendezeit in elektronischen Medien und der Platz in Zeitungen natürlich ebenso begrenzt sind wie die Zahl der Journalisten. Gerade die Ukraine hat seit ihrer Unabhängigkeit im August 1991 in der Regel ein mediales Schattendasein geführt, sieht man von der de facto gescheiterten „Orangenen Revolution“ des Jahres 2004, dem 20. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und der Fußball-EM des Jahres 2012 ab. Die Vernachlässigung des, von Russland abgesehen, flächenmäßig größten Landes in Europa habe ich stets für falsch gehalten. Auch das war schließlich ein guter Grund, doch ein Buch über die Ukraine herauszubringen. Abgesehen von meiner Einleitung hier ist das Werk in Form von Interviews gestaltet. Sie beleuchten nicht nur historische und aktuelle politische Entwicklungen der Ukraine, sondern beschreiben darüber hinaus das Leben von Menschen, die mir bei meiner Berichterstattung begegnet sind und mir – wie die Familie der Verkäuferin aus der Stadt Torez – geholfen haben, aus gefährlichen Situationen heil herauszukommen.
Die Gesprächspartner dieses Buches sind sowohl bewusst gewählt als auch das Ergebnis eines Zufalls oder Schicksals. Bewusst gewählt habe ich natürlich die historischen und politischen Persönlichkeiten: Dazu zählen der erste ukrainische Präsident Leonid Krawtschuk, der dritte Präsident der Ukraine Wiktor Juschtschenko, der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin, der letzte Botschafter der USA in der Sowjetunion, Jack F. Matlock, der ein monumentales Werk über den Zerfall der Sowjetunion geschrieben hat, Ina Kirsch zum Thema EU sowie die politischen und militärischen Akteure auf der Seite der ukrainischen Freiwilligen und der prorussischen Rebellen. Die „normalen“ Menschen sind in ihrer sozialen und geographischen Streuung bewusst gewählt, die konkreten Gesprächspartner aber eben das Ergebnis des Zufalls oder Schicksals, das uns in der Ukraine zusammengeführt hat. Nur ein proukrainischer Interviewpartner in Donezk bestand aus Sicherheitsgründen auf Anonymität, sodass weder ein Bild veröffentlicht noch ein Name genannt wird. Mein Hauptziel war es, allen Personen ein guter Zuhörer zu sein, ihren Lebensweg und ihre konkreten Lebensumstände zu verstehen, um sie dem Leser deutlich machen zu können. Über den Lebensweg der Menschen, hoffe ich, wird die Leserin auch ihr Wissen über die Ukraine vertiefen können. Natürlich habe ich die Meinungen und Äußerungen aller Gesprächspartner so wiedergegeben, wie sie gefallen sind; das gilt auch für Haltungen, von denen ich glaube, dass sie falsch sind, denn es geht nicht um meine Ansichten, sondern um die der Gesprächspartner. Korrigiert haben wir nur Fehler, die etwa Angaben zu Jahreszahlen betroffen haben.
Dieses Buch ist nicht DAS Ukraine-Buch, das ich ursprünglich schreiben wollte. Themen wie der Massenmord Stalins an drei bis sechs Millionen Ukrainern durch eine künstlich herbeigeführte Hungersnot („Holodomor“) konnten ebenso wenig in einem eigenen Kapitel behandelt werden wie eine Reportage aus Tschernowitz, das in der Monarchie den Beinamen „Klein-Wien“ trug und in dem die letzte Universität der Habsburgermonarchie gegründet wurde. Auch über Taras Schewtschenko, den Nationaldichter der patriotischen Ukraine, konnte ich nicht schreiben, dessen 200. Geburtstag im Jahre 2014 gefeiert wurde. Im Gegensatz zum albanischen Volk – durch den (völlig aus seinem historischen Kontext entrückten) Nationalhelden Skanderbeg – fehlt den Ukrainern insgesamt eine historische Persönlichkeit oder ein historisches Ereignis, das für die Bevölkerung in allen Landesteilen identitätsstiftend wirken könnte. Auch die Schilderung meiner persönlichen Erlebnisse in diesem Jahr, von der Rückkehr nach Kiew auf den Maidan, die anschließende Berichterstattung über die Abtrennung der Halbinsel Krim und meine Eindrücke und Erlebnisse in der Ostukraine auf meinen Fahrten durch das Kriegsgebiet zwischen Donezk und Lugansk sind aufgeschoben, aber, so hoffe ich, nicht aufgehoben. Dennoch wird, so meine ich, in vielen der Gespräche auch davon einiges zu lesen sein – in der Dialogsituation der Interviews ergaben sich zahlreiche spannende Aspekte, die diesem Buch seine Berechtigung geben. Eine ausführliche Erörterung dieser und anderer Themen wird einem allfälligen weiteren Buch über die Ukraine vorbehalten bleiben, sollte ich weiter dieses Land betreuen können und Interesse bei Verlag und Publikum vorhanden sein. So hoffe ich natürlich, dass das Buch Anklang bei den Leserinnen und Lesern finden sowie das Verständnis für die Ukraine vertiefen und das Interesse an ihr verstärken wird.
Der Sieg hat bekanntlich viele Väter, die Niederlage ist ein Waisenkind. Für mögliche inhaltliche Fehler bin ich verantwortlich, für die hoffentlich wenigen Druckfehler der Verlag. Ohne Hilfe, Unterstützung und Verständnis wäre dieses Buch nicht zustande gekommen. Mein Dank dafür gilt in erster Linie meiner Familie, der ich dieses Werk gewidmet habe. Meine Töchter Immanuela und Michaela sowie meine Frau Elisabeth haben nicht nur im Jahr 2014 wieder einmal ihren Vater und Ehemann kaum persönlich gesehen; sie haben mich auch in den Jahren 1992 bis 1998 insgesamt monatelang entbehren müssen, als ich mich mit der Ukraine ebenfalls intensiv befasste – ein Interesse, das in diesen Jahren bei der überwiegenden Mehrheit der Journalisten kaum auf Verständnis stieß. Verständnis dafür hatte jedenfalls das Bundesheer, das mir in seiner damaligen Form wirklich viele Möglichkeiten bot, mein Interesse an der Ukraine zu befriedigen. Von allen Organisationen, bei denen ich mich je engagiert habe, hat mich das Bundesheer am meisten für den Einsatz entlohnt. Mein erworbenes Wissen über Einsatzplanung und über Waffensysteme, mit denen in der Ostukraine gekämpft wird, hat mir bis heute sehr genützt. Als Major der Miliz erfüllt es mich mit tiefer Sorge, wenn ich die Agonie des Heeres mit ansehen muss, das grundlegende Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Noch viel betrüblicher ist es, dass die politische Elite Österreichs offensichtlich kein Verständnis für grundlegende sicherheitspolitische Fragen aufbringt oder aufbringen will und dass der Masse der Bevölkerung das Schicksal des Heeres offensichtlich nicht wichtig genug ist, um Wahlausgänge zu beeinflussen. Doch wer für die (Rest-)Neutralität Österreichs ist, muss akzeptieren, dass Neutralität etwas kostet. Mir schein es zweifelhaft, ob in Österreich die Bevölkerung massenhaft für das Heer spenden würde, wie das in der Ukraine der Fall ist, wo es von Medikamenten über Lebensmittel bis hin zu Splitterschutzwesten an allem fehlt, was Soldaten für den Einsatz brauchen. In den Einsatz geschickt hat mich der ORF, dem ich für diese Möglichkeit ebenso dankbar bin wie dem Styria-Verlag für die Zusammenarbeit an diesem Buch. Erwähnen möchte ich noch drei Kollegen im ORF, Arno Pindeus und Gudrun Gutt im Fernsehen sowie Hartmut Fiedler im Radio. Mit ihnen war die Zusammenarbeit in den kritischen Wochen und Monaten auf der Krim und in der Ostukraine besonders intensiv. Sie waren immer da, wenn es schwierige Einsätze zu erörtern und technische Probleme zu bewältigen gab. Zu danken habe ich auch meinem Fahrer Igor und meinem Kameramann und Cutter Wasilij, die über alle finanziellen Abgeltungen hinaus Einsatzfreude und Risikobereitschaft gezeigt haben. Ohne sie wären die Beiträge nicht möglich gewesen, die wir für den ORF gestaltet und die auch dieses Buch beeinflusst haben.
Das letzte und entscheidende Wort haben natürlich die Leserinnen und Leser, von denen ich mir auch rege Kommentare und konstruktive Kritik via Facebook oder E-Mail erhoffe.
Christian Wehrschütz
Donezk, Anfang September 2014
OHNE RUSSLAND WIRD ES KEINE STABILITÄT IN EUROPA GEBEN
Gespräch mit Ina Kirsch
INA KIRSCH ist Managing Director des ECFMU (European Centre for a Modern Ukraine). Die Organisation hat ihren Sitz in Brüssel, agiert international und versteht sich als Anwältin für die Verbesserung der Beziehungen zwischen der Ukraine und der EU.

CHRISTIAN WEHRSCHÜTZ: Liebe Frau Kirsch, meine erste Frage betrifft einige persönliche Daten. Erzählen Sie am Beginn ein bisschen über Ihren Lebensweg. Wo sind Sie geboren, wo aufgewachsen, wo haben Sie Russisch gelernt?
INA KIRSCH: Geboren wurde ich im fernen Osten Russlands. Ich bin die Tochter einer russischen Journalistin und eines deutschen Vaters, seines Zeichens Schriftsteller. Ich bin dann gleich nach meiner Geburt in die ehemalige DDR gezogen, dort aufgewachsen und habe dementsprechend auch Russisch gelernt.
Und wie kam es zur Geburt im fernen Osten Russlands? Wo war das genau?
In Chabarowsk. Meine Mutter war als Journalistin damals zuständig für eine entsprechende Regionalzeitung. Und mein Vater hat als Schriftsteller in der DDR eine Reise mit anderen Schriftstellerkollegen in die Region gemacht. Da haben sie sich kennengelernt.
Und wo haben Sie dann in der DDR gelebt?
In Halle, das ist in der Gegend von Leipzig, das Gebiet mit der größten Chemieindustrie in der ehemaligen DDR. Also wirklich Zentrum der Industrie im – wie wir damals gesagt haben – Arbeiter- und Bauernstaat.
Aber Halle an der Saale ist auch wegen seiner Komponisten bekannt.
Das ist wohl wahr. Herr Händel hat da gearbeitet und gelebt. Aber, also sagen wir in diese Zeit zurückblickend, in der DDR-Zeit gab es auch eine ganz große Gruppe von jungen Schriftstellern, die eben aus dieser Region kamen. Und um das Industriegebiet Leuna lebte auch ein großer Zirkel junger, nachher auch in Westdeutschland bekannter Journalisten, und sie haben in einem Schriftstellerzirkel gearbeitet.
Was war eigentlich Ihr Berufsweg? Welche Berufslaufbahn haben Sie eingeschlagen und wie begann dann überhaupt die Beschäftigung mit der Ukraine? Diese dürfte ja erst nach dem Fall der Mauer bzw. auch nach dem Zerfall der Sowjetunion 19911 so richtig begonnen haben.
Ich bin 1987, also zwei Jahre vor dem Mauerfall, von einer Besuchsreise nach England in die DDR nicht zurückgekehrt. Ich habe dann in Berlin Osteuropastudien studiert und mit dem Fall der Mauer habe ich mich schon in Westberlin bei den Sozialdemokraten politisch engagiert. Dann bin ich wieder nach Ostberlin zurückgegangen, um beim Aufbau der dortigen Sozialdemokratie zu helfen. Das habe ich auch gemacht und bin 1991 für die Friedrich-Ebert-Stiftung und sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete nach Moskau gegangen, um dort die politischen Entwicklungen zu begleiten und zu berichten, um einen wahren Blick auf die Entwicklung der Parteienstrukturen zu bekommen. Und in dem Moment habe ich dann angefangen, mich vornehmlich mit der Parteienentwicklung in Russland, der Ukraine und Weißrussland zu beschäftigen.
Sie haben aber auch in Brüssel gearbeitet, glaube ich.
Ich bin dann, als ich zurückgekommen bin aus Moskau, 1994 nach Brüssel gezogen und habe angefangen, dort für Europaabgeordnete zu arbeiten, vornehmlich aber zunächst im Bereich Innenpolitik und Haushaltspolitik. Und ich bin später wieder zurückgekehrt zu den Ursprüngen in der Außenpolitik.
1994 ist ein gutes Stichwort, denn im Juni 1994 unterzeichneten die EU und die Ukraine auch dieses Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Es gab dann ein Interimsabkommen, um es in Kraft zu setzen. Endgültig in Kraft trat dieses Abkommen 1998. Man hat insgesamt den Eindruck, dass die Europäische Union bei der Frage „Was tun mit der Ukraine?“ lange keine wirkliche Strategie entwickelt hat. Das war nie ganz klar. Natürlich gab es auch andere Probleme, andere Prioritäten. Einerseits die Erweiterungsrunde 1995. Denn mit dem Fall der Berliner Mauer standen natürlich in weiterer Folge auch die Staaten Ost-Mitteleuropas im Vordergrund. Dann haben wir noch die Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien, die parallel 1991 so richtig begonnen haben. Wann kam eigentlich der Impuls, dass man sagte, man entwickelt mit der Ukraine diese Idee, dass nicht nur Partnerschaftsabkommen, sondern auch weitergehende Abkommen, auch für Georgien, Moldawien, gelten sollen – was also die Annäherung, die Assoziierung der Ukraine und der anderen Staaten an die EU betrifft?
Zurückzuführen ist das Ganze eigentlich auf die Orangene Revolution. Als Timoschenko2 und Juschtschenko3 2004 bzw. 2005 die Macht übernommen haben, wollten sie gleich dem Weg der anderen osteuropäischen Länder, also vor allem Polens, folgen und Mitglied der Europäischen Union werden. Damals hat man eben sehr klar gesagt: Hier geht es vorläufig nicht weiter. Und man hat sich darauf geeinigt, dass man einen Schritt geht, der möglichst nah an eine EU-Mitgliedschaft heranführt, aber nicht die EU-Mitgliedschaft bedeutet, weil die damals nicht umsetzbar war. Sie wissen, wie schwierig es schon damals war, überhaupt die Osterweiterung der Europäischen Union innerhalb der alten Mitgliedstaaten der EU durchzusetzen. Also da ging kein Weg daran vorbei. Man konnte nicht Nein sagen und damals hat dann Timoschenko schon versprochen: Wir gehen so weit wie möglich. So weit wie möglich hieß: Wir streben an, die Ukraine so weit wie möglich in den europäischen Binnenmarkt zu integrieren und auch die politischen Strukturen zu schaffen, ohne dabei eine Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen. Vorläufig. Das entspricht übrigens auch genau dem Weg, den die Balkanländer, aber auch die anderen osteuropäischen Länder gegangen sind. Man hat zunächst ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen gemacht. Und als sich das mehr oder weniger gut angelassen hat, hat man später Beitrittsverhandlungen geführt.
Und 2004 wurde beschlossen, dass man so weit wie möglich geht, und hat angefangen, zu verhandeln. Aber die Verhandlungen wurden dann relativ schnell noch einmal ausgesetzt mit der Mitteilung: Wir schauen uns zunächst an, was die Verhandlungen mit der WTO ergeben, und setzen dann darauf unsere weiteren Verhandlungen auf. Es gab nämlich auch schon bei den WTO-Verhandlungen der Ukraine sehr große Probleme. Es gab den politischen Willen, um jeden Preis zu unterschreiben, auch wenn es bereits zu diesem Zeitpunkt für die Ukraine zum Teil ökonomisch nachteilig war. Die Ukraine hat, vor allem was den Agrarsektor angeht, für unsere Rohstoffe auch sehr viele Zugeständnisse an die WTO gemacht.
Wodurch?
Dadurch, dass man Tarife genommen hat, die es interessanter gemacht haben, zu importieren, als selbst im Land zu produzieren. Und in einem Land, das so rückschrittlich ist wie die Ukraine, wäre es erforderlich gewesen, zunächst auch die heimische Wirtschaft wirklich zu stärken – und nicht nur den Handel zu fördern. Und die Investitionen, die man sich von der Marktöffnung erhofft hat, sind zum Großteil einfach ausgeblieben. Man hat genau das Gleiche wie in Russland gemacht. Man hat zwar in den Stahlgebieten und Industrien weiter produziert, aber man hat nicht ausreichend modernisiert. Es gab keinen Zufluss von dringend erforderlichem Kapital. Und gleichzeitig hat die Ukraine, was wir ganz oft vergessen, auch Rohstoffe, die weltweit sehr interessant sind. Titan zum Beispiel. Man hätte eigentlich eine sehr viel stärkere Verhandlungsposition haben können, wenn man sich die wirtschaftliche, mögliche wirtschaftliche Stärke der Ukraine perspektivisch angesehen hätte. Aber man wollte damals aus politischen Gründen unbedingt sofort das WTO-Abkommen unterzeichnen. Das hat man gemacht, und man hat dadurch, wie gesagt, im Agrarsektor viele Zugeständnisse gemacht. Man ist bis heute Lieferant wenig qualitativer Rohstoffe, veredelt aber kaum eigene Produkte. Und im Fall der Ukraine hätte dieser Agrarsektor nach wie vor sehr viel Potenzial zur Entwicklung einer eigenen Industrie.
Sie leiten eine NGO 4 , eine Nichtregierungsorganisation, die sozusagen das Verhältnis Ukraine – EU, die EU-Annäherung der Ukraine, fördern soll. Wann wurde diese NGO gegründet? Wer stand dahinter und mit welchem Ziel?
Gegründet wurde das Ganze 2011, und zwar mit folgendem Hintergrund: Wir waren damals schon fast zehn Jahre am Verhandeln des Assoziierungsabkommens, aber es hatte sich totgelaufen. Und die Europäische Union war im Herbst 2010 eigentlich an dem Punkt, zu sagen, es habe keinen Sinn, weiter zu verhandeln. Timoschenko und Juschtschenko waren überhaupt nicht in der Lage, wirkliche Verhandlungen über die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Assoziierungsabkommens zu führen, wollten es auch nicht, das waren ja alles Diskussionen über Quoten und Ähnliches, die den eigenen Wohlstand bedroht hätten. Es waren mehr als 11 000 Positionen, die verhandelt wurden. Man kam nicht weiter. 2010, nach dem Machtwechsel, also hin zu Janukowitsch5, hat dann die Europäische Union gesagt: Entweder ihr macht das jetzt richtig oder wir lassen es sein. Daraufhin wurde dann der Beschluss gefasst: Nein, wir, also die Ukraine, wollen die Assoziierung haben und wir werden das intensiv betreiben. Zum damaligen Zeitpunkt, nach der Orangenen Revolution, eigentlich auch nach der ganzen Instabilität zwischen Timoschenko und Juschtschenko, wurde Janukowitsch als jemand gesehen, der die Stabilität ins Land zurückbringen könnte. Das hatten sich die Bürger erhofft und selbst der Westen stand Janukowitsch zwar skeptisch, aber doch relativ offen gegenüber. Und in dieser Zeit wurde dann gesagt: Okay, wir machen dieses Assoziierungsabkommen weiter, und man hat den damals Ersten Stellvertretenden Premierminister Andrij Kljujew6 beauftragt, die Verhandlung zu führen und sich der Europäischen Union anzunähern. Gleichzeitig haben damals die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament gesagt: Wir müssen eine engere Zusammenarbeit mit der Partei von Janukowitsch suchen. Wir können die Partei mit mehr als einer Million Mitgliedern nicht im luftleeren Raum, ohne Partner in Europa, schweben lassen. Timoschenko und Juschtschenko waren Mitglieder der Europäischen Volkspartei, der ja, wie wir wissen, auch die ÖVP und die CDU, vor allem die CDU ist die treibende Kraft dahinter, angehören. Aber man hat gesagt, Janukowitschs Partei müsse Hilfe bei der Europäischen Orientierung bekommen. Sie müsse sich zu einer normalen europäischen Partei entwickeln können. Und wir wollen ihr dabei helfen. Damals wurde auf europäischer Ebene eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Es ging nicht um die Mitgliedschaft der Partei der Regionen in der europäischen Sozialdemokratie, sondern es ging darum, ihnen wirklich bei einer Vernetzung zu helfen, damit auch die Politiker der Partei von Janukowitsch, die Ost-Ukraine mit starken Bindungen nach Russland, Zugang zu Europa finden würden. Und im Umfeld dessen wurde damals gesagt: Wir müssen jetzt die Kommunikation zwischen den europäischen Strukturen und der Ukraine fördern. Denn man hat keine gemeinsame Sprache gefunden. Man hat eben auf verschiedenen Ebenen gearbeitet, während die Europäische Union innerhalb der Hierarchie Entscheidungen von unten nach oben trifft, ist es in der Ukraine umgekehrt. Die Entscheidungen in der Ukraine werden nach wie vor von oben nach unten getroffen. Man hat keine Möglichkeit gefunden, wirklich miteinander zu kommunizieren, um die technischen, alltäglichen Probleme zu klären. Und deshalb haben wir damals eine Organisation gegründet, zusammen mit Ukrainern und Europäern, die gerade in diesem Fall helfen sollte.
Wann begannen ungefähr die Verhandlungen zwischen der Ukraine und der EU über dieses Assoziierungsabkommen? Was waren die Knackpunkte? Und hatte die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 Einfluss auf diese Verhandlungen?
Es begann, wie gesagt, 2004, gleich nachdem die Partnerschaftsabkommen in Kraft getreten waren. Wobei wir übrigens sagen müssen, auch da hat die EU, obwohl das Abkommen schon sehr lange fertig war, gewartet, bis es einen Machtwechsel in Kiew gab, um es in Kraft treten zu lassen. Also man hat auf Timoschenko und Juschtschenko gewartet, denn man wollte Kutschma7 damals nicht unterstützen. Und dann begannen die Verhandlungen, aber die haben sich sehr schnell totgelaufen. Und es gab eine neue Intensivierung 2010. Tatsächlich ging es schon um ganz klare Punkte, also um den Teil des Freihandelsabkommens, das machte den Großteil des ganzen Abkommens aus. Wenn die Ukraine das irgendwann mal umgesetzt und komplett implementiert haben wird, wird sie 80 % oder mehr der Bedingungen des europäischen Binnenmarkts erfüllt haben. Aber da ging es wirklich um jede Quote, um jede kleinste: welche Autos produziert werden, wie viel Mais, wie viel Weizen exportiert, importiert werden darf. Welchen Schutz es gibt und Ähnliches. Also das wurde damals alles gemacht. Vor allem Kljujew hat ja das Ganze betrieben, der dieses Abkommen unbedingt haben wollte. Denn man war sich sicher, dass eine Modernisierung der Wirtschaft der Ukraine nur mit Hilfe der europäischen Industrie, des europäischen Marktes erfolgen kann. Deshalb hat man dieses Abkommen damals vorangetrieben.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Partei von Janukowitsch sich sehr stark aus oligarchischen Strukturen zusammengesetzt hat. Ihre Führungspersönlichkeiten bezeichnen wir als oligarchisch – und diese haben natürlich wirtschaftliche Interessen. Die haben sehr klar gesehen, dass es eine Notwendigkeit für die Modernisierung gibt. In der Partei von Janukowitsch gab es eine Auseinandersetzung zwischen den Wirtschaftskräften, die sich eher nach Europa orientieren, und denen, die sich eher nach Russland orientieren. Aber bis zum Schluss hatte sich eigentlich eher die Gruppe durchgesetzt, die diese europäische Organisation wollte. Deshalb hat man das Abkommen in der politischen Klasse und der Bevölkerung propagiert und, wie auch vorher bei der WTO, sehr große Zugeständnisse im Bereich der Quoten gemacht, vor allem im Bereich der Landwirtschaft. Wenn man sich die Quoten für solche elementaren Exportprodukte wie Sonnenblumenöl oder Mais ansieht, für die die Ukraine minimale Quoten ihrer jährlichen Produktion für den Export in die EU bekommen hat, dann wird deutlich, dass es eigentlich den politischen Willen eines Teils der politischen Elite um Janukowitsch gab, die Ukraine unter Aufgabe vieler eigener Interessen an die wirtschaftlichen Strukturen der EU heranzuführen.
War dieses Interesse, abgesehen von der Modernisierung, auch dadurch gegeben, dass sich viele Großunternehmer der Ukraine – oder die Oligarchen, wie man sie dort bezeichnet – durch die EU-Annäherung auch Schutz vor den russischen Oligarchen erwartet haben?
Das würde ich nicht so sehen. Denn viele russische Oligarchen sind auf dem ukrainischen Markt aktiv, weil auch sie diesen Freiraum sehr genießen, den sie eigentlich in Russland nicht haben. Es gibt in der ukrainischen Wirtschaft eine sehr starke Pluralität, die unter Janukowitsch zwischen den verschiedenen Oligarchen sehr austariert war, während wir in Russland eigentlich davon sprechen, dass es nur Unternehmensführer unter der Führung von Putin gibt. Es gibt eigentlich keine eigenständigen russischen Oligarchen. Die Wirtschaft wird in Russland sehr zentralistisch geführt. Das ist in der Ukraine anders. Und das heißt, man hat sich was anderes erhofft.
Diejenigen, die die Annäherung an Europa vorangetrieben haben, wollten eigentlich erreichen, dass man Schutz für die Investoren hat, sich das Investitionsklima verbessert. Denn bei jedem Machtwechsel in der Ukraine – das haben wir jetzt auch wieder gesehen und das ist eines der ganz großen Probleme – übernimmt die Gruppe, die die Macht übernommen hat, eigentlich das ganze wirtschaftliche Vermögen der vorigen Macht. Man wollte also Stabilität erreichen, damit zukünftig Investitionen in der Ukraine auch dauerhaft sicher sind. Bei jedem Machtwechsel zuvor hat es diesen Wechsel gegeben, man hat wieder renationalisiert und anschließend privatisiert. Kein inländischer und kein ausländischer Investor kann unter solchen Umständen dauerhaft wirtschaften. Das war eine sehr wichtige Sache, man hat sich wirklich Rechtssicherheit erhofft, sodass es nicht mehr eine Willkür von Gerichten gibt. Sondern man wollte, dass wirklich normale Verträge standhalten.
Wir können uns jetzt unter Janukowitsch ansehen, wie die Gerichte gearbeitet haben und ausländischen Investoren ihre Investitionen einfach weggenommen haben. Das Gleiche gab es unter Juschtschenko und Timoschenko, wobei das Stockholmer Schiedsgericht Jahre später Entscheidungen rückgängig gemacht hat. Sie sehen das jetzt auch wieder, es passiert genau das Gleiche, nämlich dass die Gerichte auf politischen Zuruf hin Unternehmen einfach beschlagnahmen, nationalisieren, Verkäufe annullieren, obwohl diese eigentlich nach internationalem Recht geschlossen wurden. Es gibt keine Rechtssicherheit. Es gab sie damals nicht und es gibt sie heute nicht. Und gerade da hoffen die Unternehmen darauf, dass diese Rechtssicherheit durch die europäischen Gesetze gegeben sein wird.