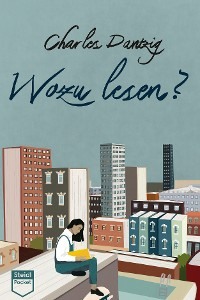Czytaj książkę: «Wozu lesen? (Steidl Pocket)»
Charles Dantzig, geboren 1961, publiziert seit den 1990er Jahren Lyrik, Romane und Essays. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt Charles Dantzig den Prix de l’Essai der Académie française und den Grand prix der Elle-Leserinnen. Dantzig ist Lektor im französischen Verlag Grasset und lebt in Paris. Bei Steidl erschienen von ihm außerdem Das Meisterwerk (2016) und New York, noir (2019).
CHARLES DANTZIG
WOZU LESEN?
Aus dem Französischen von Sabine Schwenk
Steidl Pocket
»Suche das Paradies.«
Chaldäischer Orakelspruch
Inhalt
Cover
Titel
Lesen lernen
Lesealter
Der egoistische Leser
Lesen verändert uns nicht
Lesen, um sich selbst zu finden (ohne sich gesucht zu haben)
Der Gott der Lektüre
Lesen, um sich auszudrücken
Ein Tanz im Verborgenen
Lesen belebt neu
Lesen, um die Leichen nicht ruhen zu lassen
Man liest nur aus Liebe
Lesen aus Hass
Darf ich bitten?
Die angenommene Passivität des Lesers?
Die fügsame Leserin
Lesen, um die Buchmitte zu überwinden
Um der Titel willen lesen
Lesen, um nicht mehr Königin von England zu sein
Lesen und Macht
Lücken lesen
Lesen, um zu masturbieren
Lesen, um sich zu widersprechen
Der Form halber lesen
Der Moment, in dem man liest
Der Ort, an dem man liest
Lesen für die Finsternis
Lesen, um zu lernen
Lesen, um sich zu trösten
Ah, lesen für die Gesundheit
Oh, lesen für die Tugend
Lesen aus Lust
Lesen, um sich abzusondern
Erfahren, dass Lesen niemanden bessert
Nach dem Akt
Lesen, um gelesen zu haben
Die Gefahren des Lesens
Lesen, um nicht auszuweichen
Der naive Glaube des Lesers an die Lektüre
Lesen, um Freunde zu finden
Dramen lesen
Lesen unter Eingeweihten
Der Leser ist ein Phrasen-Sack
Lesen heißt, sich tätowieren lassen
Lesen, um Dinge zu entdecken, die der Schriftsteller nicht geschrieben hat
Lesen als Laster
Gegen die Vernunft anlesen
Durch Krusten hindurch lesen
Schlechte Bücher lesen – nichts als Vampire
Geheimnisse und Mysterien
Ein Lese-Poker
Klassiker lesen
Dinge lesen, die nirgends stehen
Lesen, um sich zu verjüngen
Lesend die Zeit vertreiben
Lesen, um nicht zu lesen – Biographien
Ohne Rücksicht auf den Schriftsteller lesen
Falten lesen
Keine Bücher lesen
Im Flugzeug lesen
Am Strand lesen
Von Buchhandlungen und Glühwürmchen
Lesen, um Bücher zu präsentieren
Spielend leicht lesen
Über die Buchseiten hinaus lesen
Lesen, wenn man Schriftsteller ist
Vorlesen
Interviews lesen
Als Freund lesen
Die Leser sind die wahren Erben
Lektüre
Wer liest Meisterwerke?
Lesen, um aus einer Betäubung aufzuwachen
Lesen braucht kein gebundenes Papier
Warum nicht lesen?
Wie lesen?
Bücher
Bildnachweis
Impressum
Lesen lernen
Warum lese ich? Ich lese wohl so, wie ich auch gehe. Übrigens lese ich tatsächlich beim Gehen. Wenn Sie wüssten, wie viele Begegnungen mir dies schon beschert hat! So manche Pariser Parkuhr hat schon gerührt gehört wie ich mich mit »Pardon, Monsieur!« bei ihr entschuldige, nachdem ich sie lesend angerempelt habe. Doch bloß weil man eine Sache so spontan tut wie gehen oder lesen, ist es keineswegs überflüssig, darüber nachzudenken. Spontaneität rechtfertigt nicht alles. Auch Morde werden spontan verübt.
»Spontan« – zuerst wollte ich »natürlich« schreiben. Aber Lesen ist selbstverständlich nicht so natürlich wie Gehen. Nein, es ist eine durch und durch erworbene Fähigkeit. Was manchen schwerfällt. Nicht jeder lernt leicht lesen. Dem nachzugehen, wäre interessant. Sind Vielleser möglicherweise Menschen, die ohne Mühe lesen gelernt haben? Bei mir persönlich war es leicht und klappte fast auf Anhieb. Ein paar Tage lang ließ man mich das Abc üben, und plötzlich ging alles wie von selbst – ich las. Vielleicht lag es daran, dass ich vergleichsweise spät damit anfing, in der ersten Klasse, ich war fünf. Seit einem Jahr lebte ich in einem Zustand der Empörung, denn die meisten meiner Freunde hatten bereits in der Vorschule lesen gelernt. »Und was ist mit mir? Warum bringt man mir nichts bei?«, lag ich meinen entnervten Eltern pausenlos in den Ohren. »Dein Kindergarten sieht das nicht vor. Du musst bis zur Grundschule warten«, war die einzige Antwort, die sie mir geben konnten. Und so zeigte ich weiter auf alles, was mir an Geschriebenem unterkam, Plakate, Schilder, Magazincover, und fragte: »Was steht da?« Ich hatte das Gefühl, dass mir großes Unrecht geschah. Dass man mir bis auf Weiteres den Zugang zum Verständnis der Welt verwehrte.
Im Alter von fünf Jahren sind Kinder sehr intelligent. Und naiv. Über die Schrift, so dachte ich, würde ich begreifen, was sich um mich herum ereignete. Denn auch was sich vor meinen Augen ereignete, blieb mir unverständlich. Was war, wenn nicht der Ursprung von allem, so doch sein Zusammenhang? Wie war das alles miteinander verbunden? Ich vertraute voll und ganz darauf, dass die Schrift es mir verraten würde. Dem gesprochenen Wort dagegen misstraute ich. Vor allem dem Wort meiner Eltern. Bevor ich eingestand, wie geistreich es war, spürte ich seine Macht, der ich mich sogleich widersetzte. Autorität war immer ein Problem für mich. Noch heute gibt es nichts, was mich so sehr in Rage bringt wie das, was man Machtworte nennt. Sie stellen sich dem wunderbaren Räsonnement entgegen – wunderbar deshalb, weil es auf Vertrauen beruht. Machtworte hingegen beruhen auf Verachtung. Meinem Argwohn gegenüber Autoritäten entsprach ein fast magisches Vertrauen in die Schrift. Dem kleinen Banausen, der ich damals war, schien jeder Satz ein Schlüssel zu sein. Hatten Sätze etwa keine frappierende Ähnlichkeit mit Schlüsseln? Schwarz, lang, dazu die Ober- und Unterlängen, die aus dem Zylinder zu ragen schienen wie die Räute – so nennt man den Griff des Schlüssels, glaube ich. Hier liegt nebenbei bemerkt ein Nutzen von Wörtern: Kurz und präzise ersparen sie einem ganze Sätze. Dieses Schlüsselbund jedenfalls, das die Bibliothek meiner Familie für mich darstellte, würde mir die Türen zur Schatzkammer öffnen. Das Geschriebene war in meinen Augen etwas Abstraktes und Selbstloses, das mit seinen Wörtern nichts erreichen wollte.
Ich frage mich, ob ich damals nicht unbewusst das Wesen der Literatur erahnt habe. Eine mögliche Definition lautet, Literatur sei die wohl einzige Textform, die keinen unmittelbaren Zweck erfülle. Literatur steht im Kern meiner Frage: Wozu lesen? – Wozu Literatur lesen?
Man kann historische Abhandlungen lesen, politische Programme, Astronomie-Lehrbücher, Anleitungen zum Bridge- Spielen, doch das alles dient nur dazu, sich Wissen anzueignen. Aber Wissen ist keine große Sache. Jeder weiß etwas. Heerscharen von Dummköpfen und Einfaltspinseln sind vollgestopft mit Wissen. Wichtiger ist, was man als Analogie bezeichnen könnte. Literatur, insbesondere Belletristik, ist eine Form von Analogie. Oder genauer gesagt, eine der Formen des Verstehens mittels Analogie. Oder noch genauer gesagt, eine der Formen des Verstehens mittels Analogie, die nicht nur die Intelligenz, sondern auch die Emotionen bemüht. Analogie, Emotion. Genau darin liegt der Unterschied zur Philosophie, die sich ganz auf die Analyse und den Intellekt stützt.
Natürlich macht eben dieser emotionale Aspekt der Literatur ihren Reiz aus. Und ihre Gefahr. Mit ihren Bildern vermag sie uns zu manipulieren wie Kinder. Aber sie lässt uns Zusammenhänge schneller verstehen, andere Zusammenhänge als Philosophie oder Psychologie. Und dieses Buchwissen … Buchwissen. Ich habe die negative Konnotation dieses Wortes nie ganz begriffen. Es ist dieselbe negative Bedeutung, welche die Gesellschaft allen geistigen Dingen zuschreibt, eine Gesellschaft, die roh geblieben ist unter dem Mäntelchen dessen, was man Zivilisation nennt und was kaum mehr ist als ein paar Tischmanieren. Man nehme das Argumentieren. Ich bezweifle, dass man es wirklich wertschätzt. Fordert ein Kind die Eltern mit seiner Argumentierfreude heraus, schimpfen sie es einen Besserwisser. Und dann die vielseitigen Beschimpfungen aus dem Feld der Literatur. Wer sich gern mit Geschriebenem beschäftigt, ist eine Leseratte oder ein Bücherwurm, wer sich nicht kurzzufassen versteht, erzählt Romane, und wer zur Hysterie neigt, macht Theater. Man stelle sich den Skandal vor, wenn ich es wagte, mit derselben Verachtung »Was für eine Fleischerei!« zu sagen. Die Fleischerinnung würde mir den Prozess machen, es gäbe eine Fernsehdebatte, man würde mich drängen, als reuiger Sünder aufzutreten. Und man hätte ja Recht. Keine Gruppe ist per se hassenswert. Leute, die das Lesen und die Literatur verunglimpfen, sollten sich selbst anklagen und zugeben, wie viel Gutes im »Buchwissen« steckt. Für mich jedenfalls gilt, dass fast alle guten Dinge, die ich gelernt habe, aus Büchern stammen. Und mein Verständnis der Welt oder das bisschen Verständnis, das ich von ihr habe, hat sich erst in dem Moment zu trüben begonnen, als ich dem Buchwissen meine persönliche Erfahrung hinzufügte.
Meine ganze Kindheit hindurch hieß es: »Nun spiel doch mal im Garten!« Zwar hielt man das Lesen nicht für schädlich, so vulgär ist meine Familie nicht, aber man beklagte die fehlende Abwechslung. Denn ich kannte nur einen einzigen Zeitvertreib: lesen. Um meinen Eltern eine Freude zu machen, spielte ich hin und wieder. Unter den verzückten Blicken meiner Mutter schob ich ein kleines Auto über eine mit Kreide gezeichnete Straße und langweilte mich dabei gehörig. Ich glaube, als Kind verabscheute ich Pflichten, besonders die eine: zu spielen. Beim Lesen hatte ich sehr viel mehr Spaß als beim Spielen oder gar beim Sport. Ich beschäftigte mich mit meinen Spielzeugautos, und wenn das elterliche Bedürfnis nach kindischen Dingen befriedigt war, wandte ich mich wieder meinem größten Glück zu: dem Lesen, das so viel interessanter ist als jede Form der Zerstreuung.
Lesealter
Als Kind predigt Madame du Deffand ihren Klassenkameraden den Atheismus. Man schickt einen Priester zu ihr, niemand Geringeren als den Prediger Massillon. Er eilt voller Unruhe zu ihr, arbeitet er doch an der Grabrede für Ludwig XIV., die er in zehn Jahren halten wird. Raschelnde Soutane. Er schließt sich mit dem Kind ein. Sie unterhalten sich. Wie hart wird die Strafe wohl ausfallen!, murmeln die Schwestern, die fürchten, zu weit gegangen zu sein. Bischof Massillon kommt heraus. Die kleine Schar tritt zu ihm. »Sie ist charmant«, lautet sein Urteil.
Charmant war vor allem die Epoche der Aufklärung jedenfalls für eine Oberschicht von fünftausend Leuten. (In meiner Familie wird man zu dieser Zeit in der Küche Kochtöpfe gescheuert haben.) Man könnte glauben, inzwischen habe der Geist der Mäßigung triumphiert, aber keineswegs, die revolutionären Kräfte der Vergangenheit sind da, frisch wie eh und je, und auch heute wieder werden wir von Religionsstürmen umtost: Einen Tag nach dem Erdbeben in Port-au-Prince 2010 gingen zehntausend Zeugen Jehovas – zehntausend! – unter der Führung eines Geistlichen auf die Straße und schrien: »So stand es geschrieben! Luxus und Unzucht wurden bestraft! So stand es geschrieben!« Die Frömmigkeit ist die Rache der Armen, die Katastrophe der Trost der Unglücklichen. Und die Illusion umgibt das alles mit einem Heiligenschein. So kam es, dass diese Unglücklichen – weit härter getroffen als die Reichen, welche die Mittel hatten, das Land zu verlassen oder ihr Haus wieder aufzubauen, wenn es dem Beben nicht ohnehin standgehalten hatte – unter der Führung von Scharlatanen tatsächlich Genugtuung empfanden. Unser Bedürfnis nach Aberglauben ist unersättlich.
Ich war, wie Madame du Deffand, ein atheistisches Kind. Ohne öffentliches Bekenntnis, still und leise. Der Kommunionunterricht war für mich die Langeweile auf Erden und die Beichte ein Skandal. Erst besorgt und dann verärgert darüber, mir glaubhafte Sünden ausdenken zu müssen, fand ich mich trotzdem damit ab. Das Einzige, was mich wirklich empörte, war, dass ich mich in der Messe derart langweilen musste. Zum Glück hatte mir meine überaus fromme Großmutter mütterlicherseits eine Lederhülle für das Messbuch geschenkt. Darin versteckte ich Stendhals Kartause von Parma und las diese mit einer Passion, die den Kirchendamen zu Herzen ging.
Alles was nicht meinem Alter entsprach, mochte ich damals sehr. Schon seit Jahren stibitzte ich aus der Bibliothek meines Vaters Verlaine und Musset, die ersten beiden Schriftsteller für Erwachsene, die ich las. Schenkte man mir Unterhaltungsliteratur, war ich unzufrieden. Ich weiß noch, wie schockiert ich war, als ich mit elf oder zwölf einen Jules Verne geschenkt bekam. Das Bild dieses Skandals ist mir noch gegenwärtig, der Einband des Taschenbuchs mit derselben Illustration wie auf der Hetzel- Ausgabe. Man hielt mich für ein Kind! Ha! Erwachsene, ich hatte euer Komplott durchschaut! Uns durch harmlose Lektüre gefügiger machen! Um mich davor zu schützen, hatte ich meine Höhle des Platon, die Bibliothek meiner Familie. Alle Schätze dieser Welt lagen dort griffbereit. Ich erforschte sie wie ein Archäologe, der zwischen Tausenden von Sarkophagen die Qual der Wahl hat. Ich brauchte sie nur zu öffnen, damit die Mumien zu mir sprachen, sangen. Ich war sehr empfänglich – und bin es noch – für etwas, was ich damals natürlich nicht zu benennen vermochte, etwas, was man als die Melodie des Denkens bezeichnen könnte. Vielleicht ist mit ihr ein weiterer Wesenszug der Literatur benannt.
In der Adoleszenz verdunkelt sich alles und wird undurchdringlich. Noch heute erinnere ich mich an diesen leidvollen, schmerzlichen Prozess, in dem ich mein sicheres Gespür für die Welt verlor. Ich verstand gar nichts mehr. Plötzlich ging es mir wie den Unglücklichen von Haiti: Im Alter von ungefähr sechzehn Jahren hatte ich durch die Lektüre einen Anfall von Katholizismus. Der Mann aus Nazareth von Anthony Burgess, eine Lebensgeschichte Jesu, hatte mich so getroffen, dass ich anfing, an Gott zu glauben. Die literarische Nachahmung anderer ist für uns Schriftsteller ein wichtiger Antrieb, und an diesem Roman hatte mir Zweierlei gefallen: der Rhythmus und eine Kritik. Der Rhythmus war kraftvoll, und der Widerspruch richtete sich gegen einen Gemeinplatz. Burgess schreibt, die Darstellungen, die Jesu als mageren Mann zeigten, seien absurd. Dieser Sohn eines Zimmermanns, der mit Holzstämmen hantiert und zu Fuß Palästina durchstreift habe, sei selbstverständlich ein robuster Kerl gewesen. Weder Burgess noch ich hatten an die barocken Kruzifixe gedacht, bei denen sich ergebene Bildhauer durchaus daran ergötzten, füllige Schenkel und knackige Bizeps zu gestalten. Genau das war meine Schwäche, war es lange Zeit und ist es zweifellos immer noch, diese Lust am Widerspruch. Man kann mir zugutehalten, dass ich mir genauso gern widersprechen lasse. In Meinungsverschiedenheiten habe ich immer ein Vergnügen, ja eine Kunst gesehen. Mir liegt weniger daran, Recht zu behalten, als daran, in Gesellschaft von Menschen zu sein. Man unterhält sich, man diskutiert, man streitet sich, man versucht zu argumentieren, man ist zusammen. Wer mir widerspricht, ist mein Bruder. Man könnte eine Warnung auf Buchrücken drucken: »ACHTUNG! Bücher, die Ihrer Meinung oder Ihrem Geschmack zu sehr entgegekommen, gefährden Ihre Gesundheit.«
In schwachen Momenten kann das Lesen tatsächlich gefährlich sein. Verantwortlich dafür ist nicht das Buch und auch nicht der Leser allein, sondern das unglückliche Zusammentreffen beider. Auf die Liste der Bücher, die man in schwierigen Momenten nicht lesen sollte, gehört:
| Buch | Situation |
| Der Knacks, Francis Scott Fitzgerald | wenn man sich am Rand einer Depression befindet |
| Mein Kampf, Adolf Hitler | wenn man seit Jahren arbeitslos in einem Land mit hoher Inflationsrate lebt. |
und viele mehr. Im Grunde kann wohl alles gefährlich sein, auch das Leben, aber dem gibt man nie die Schuld.
In der sechsten Klasse habe ich miterlebt, wie sich meine Mutter von einem besorgten Lehrer abkanzeln ließ, weil ich Baudelaire las. Ich vergötterte das Gedicht »Das frühere Leben«, welches ich auf die Rückseite eines Posters geschrieben und in meinem Zimmer in einen Schrank geklebt hatte und wie ein Geheimnis hütete. Beim Lesen offenbaren sich unzüchtige, wertvolle und fragile Dinge, man muss nicht alles davon preisgeben. Wenn man ein Buch so liest, wie man eben liest, das heißt still über die Seiten gebeugt, dann sind aus diesem Tête-à-Tête all die Schwindler, Rohlinge und Dummköpfe verbannt, die sich so gern entrüsten, sei es aus Eigennutz oder aus echter Überzeugung. Ich jedenfalls berauschte mich an Baudelaires Gedicht, an den ersten Zeilen: »Ich wohnte lang in einem Säulenwald / Den Meeressonnen bunt in Feuer tauchten«, ein Tableau wie eins der Gemälde von Lorrain, in die ich vernarrt war, Gemälde, auf denen triumphierende und schwermütige Prinzessinnen in der Abenddämmerung an Bord bauchiger Schiffen gingen. Dreißig Jahre später weigerte ich mich, an einer Fernsehsendung über Kinder teilzunehmen, in der ich Literatur empfehlen sollte. »Ich habe dazu nur das eine zu sagen: ›Gebt ihnen Bücher, für die sie noch zu jung sind‹«, antwortete ich dem Journalisten, der mich eingeladen hatte. Mir persönlich ist es damit nicht allzu schlecht ergangen. Kinder haben eine sehr ausgeprägte Moral, sie können sehr gut auseinanderhalten, was gut und was böse, was zulässig und was verwerflich ist. Sie sind unempfänglich für das Perverse und interessieren sich nur für das, was sie wollen. Und vielleicht weckt die Literatur ja ihr ästhetisches Empfinden.
Der egoistische Leser
In der Bibliothek meiner Großmama mütterlicherseits standen limitierte Ausgaben in Hülle und Fülle, die sie grands papiers nannte, darunter auch einige handsignierte Werke berühmter Schriftsteller. Das fand ich vornehm, und es steigerte meine ohnehin schon unermessliche Liebe zu dieser Frau. Über Großmutter-Schriftsteller sollte mal jemand ein Buch schreiben. Es gibt Mutter-Schriftsteller wie Albert Cohen. Es gibt Schwester-Schriftsteller wie Flaubert. Es gibt Vater-Schriftsteller wie Stendhal oder Dickens. Es gibt Onkel-Schriftsteller wie Roger Nimier.
Die Göttergestalt unter den Großmutter-Schriftstellern ist wohl Marcel Proust. Selbst wenn er sein Gelächter hinter dem Ziegenlederhandschuh kaum mehr verstecken kann, während er Zoten zum Besten gibt, ist ihm der wohlwollende Blick einer alten, weißhaarigen Dame gewiss, die streng ist und gütig zugleich und für ihr Leben gern liest. Eben diese Großmutter, nämlich die des Erzählers in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, hat mir nahegebracht, wie reizvoll scheinbar ungewöhnliche Vergleiche sein können. Sie ist diejenige, die eine Ähnlichkeit zwischen Mme de Sévigné und Dostojewski zu erkennen glaubt. Meine brachte mir den Umgang mit wertvollen Büchern bei, deren Code und Verhaltenskodex. Wie die verschiedenen Prägungen auf den ersten Buchseiten zu deuten sind und wie man sie vorsichtig aufschlägt. Hingebungsvoll streichelte ich über das Japanpapier, das sich feiner anfühlte als poliertes Elfenbein. Zu den Schändlichkeiten der heutigen Zeit zählt neben den theokratischen Diktaturen und den Genoziden – wobei, nein, die hat es schon immer gegeben, und da die Gewalt ewig ist und außerordentlich tief im Menschen wohnt, finden die zarten, anrührenden Momente des Lebens gerade an der oft so argwöhnisch beäugten Oberfläche statt, die doch immerhin auch der Ort ist, an dem die Blumen gedeihen, und – ja, ja, ich höre ja schon auf, zu diesen Schändlichkeiten zählt also auch die Tatsache, dass heutzutage kein Japanpapier mehr hergestellt wird. Ich hoffe, dieser Verlust wird durch andere Preziosen aufgewogen.
Japanpapier war freilich nicht das, worauf ich mich stürzte, wenn ich allein war. Wer liest, muss nicht bibliophil sein, genauso wenig wie ein Bücherliebhaber lesen muss. Man schaue sich nur den Beliebtheitsgrad diverser Schriftsteller an: Georges Duhamel hat aufgrund seiner limitierten Auflagen gerade bei bibliophilen Antiquariaten noch einen hohen Stellenwert, nach dem Urteil der Leser taugt er hingegen nicht mehr viel. Tony Duvert steht bei den Ersten nicht hoch im Kurs, wird aber von Letzteren hochgeschätzt. Ich selbst wollte damals in erster Linie Gedrucktes, das man unterstreichen und dessen Ränder man mit Anmerkungen versehen konnte. Man hatte mir beigebracht, dies sei die beste Art zu lesen, und so ist es auch. Ein Leser ist kein Konsument, der Büchern den Garaus macht, indem er sie verspeist: Wenn man sagt, jemand verschlinge ein Buch, so halte ich dies für ein gewagtes Bild. Ein guter Leser schreibt, während er liest. Er umrandet, streicht durch, kritzelt Kommentare in alle Zwischenräume, die ihm der Buchdrucker gelassen hat. Jeder, dem ich meine Proust- Bände zeige, kann verstehen, warum ich mir regelmäßig neue Ausgaben kaufe. Nicht aus Fetischismus. Ich habe keine andere Wahl. Die Vorsatzblätter und Seitenränder sind gespickt mit meinen Notizen, die wie Regenwürmer in alle Richtungen kriechen und sich bis in die Bundstege hineinwinden; die Zeilen sind unterstrichen, umkringelt, vollgekritzelt. Nicht einmal die Proust’schen paperoles können quantitativ mit meinen Anmerkungen konkurrieren. Ein guter Leser setzt seine Brandzeichen auf die Bücher und nimmt sie damit wie eine Herde in Besitz.
Vergliche man die Anmerkungen zweier Leser zu ein und demselben Text, würde man erkennen, dass ein Buch keine Skulptur ist, die man sich anschauen kann und die – Katastrophen ausgenommen – ihre ersten Betrachter weit überlebt. Auch wenn ein Buch einen eigenen Sinn, den des Autors hat, nimmt jeder Leser diesen in anderer Weise auf. Dies veranlasste Paul Valéry zu der Bemerkung:
»Meine Verse haben den Sinn, den man ihnen gibt. Der, den ich ihnen gebe, passt nur für mich und kann vor niemandem geltend gemacht werden. Es ist ein Fehler, der dem Wesen der Poesie zuwiderläuft und sogar tödlich für sie wäre, zu behaupten, dass jedes Gedicht einen wahren, einzigen Sinn hat, der mit dem Denken des Autors identisch ist.«
Paul Valéry, Kommentar zu Charmes
Man liest, um die Welt zu verstehen, man liest, um sich selbst zu verstehen. Und wenn man über ein gewisses Maß an Großzügigkeit verfügt, kommt es auch vor, dass man liest, um den Autor zu verstehen. Ich glaube allerdings, dass nur die größten Leser dazu in der Lage sind, und auch sie erst dann, wenn sie die zwei dringendsten Bedürfnisse befriedigt haben: das Verständnis der Welt und der eigenen Person. Lesen bringt Mumien zum Singen, aber deshalb liest man nicht. Man liest nicht für das Buch, man liest für sich selbst. Es gibt nichts Egoistischeres als einen Leser.