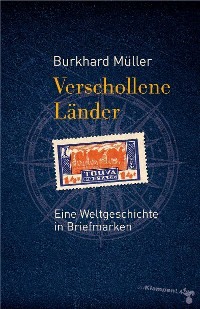Czytaj książkę: «Verschollene Länder»
Burkhard Müller
Verschollene Länder
Eine Weltgeschichte in Briefmarken

Burkhard Müller, Jahrgang 1959, ist Dozent an der Technischen Universität Chemnitz. Er schreibt regelmäßig für die Kulturseiten der »Süddeutschen Zeitung«. 2008 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet. Im zu Klampen Verlag erschienen in den vergangenen Jahren »Schlussstrich. Kritik des Christentums« (2004); »Der König hat geweint. Schiller und das Drama der Weltgeschichte« (2005), »Die Tränen des Xerxes. Von der Geschichte der Lebendigen und der Toten« (2006) und »Lufthunde. Portraits der deutschen literarischen Moderne« (2008).
Inhalt
Cover
Titel
Über den Autor
Vorwort
Thule
Panamakanalzone
Königreich Hannover
Biafra
Flandern
Königreich Hawaii
Das Land ohne Namen
Labuan
Palästina
Spitzbergen
Obervolta
Empire Français
Südvietnam
Sansibar
Valle Bormida
Karolinen
Tannu-Tuva
Konföderierte Staaten von Amerika
Martinique
Sowjetunion
Neue Hebriden
Nordschleswig
Das Reich, in dem die Sonne nicht untergeht
Schwarzflaggenrepublik
Hatay
Generalgouvernement
Occussi Ambeno
Hedschas
Angra
Ingermanland
Oranje
Bolivar
Vereinigte Arabische Republik
Königreich Neapel
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren
Neufundland
Französisch-Äquatorialafrika
Feuerland
Fiume
Lundy
Mandschukuo
Elobey, Annobón und Corisco
Kaiserreich Mexiko
Hyderabad
Osmanisches Reich
Rhodesien
Estado da India
Buenos Aires
Futsches Reich
Katalonien
Inseln unter dem Winde
Königreich Sedang
Zaire
Vereinigtes Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen
Persien
Tanger
Charkhari
Batum
Rhodos
Deutsche Lande
Impressum
Vorwort
Die politische Geographie des Erdballs ist komplett. Kein Flecken Land, der nicht unter die Souveränität eines der 196 Staaten fiele, die es im Jahr 2013 gibt und die sich sämtlich eingerichtet haben, als müssten sie bis in alle Ewigkeit dauern. Nur ungern lassen sie sich daran erinnern, dass es nichts Fragileres gibt als Grenzen. Alle Grenzen, die älter sind als die ihrigen und andere Rechtsgebilde einschlossen als sie selbst, sind ihnen darum nicht einfach nur vergangen; sie sind hinabgedrückt und überdeckt worden, wie die Grundmauern römischer Villen, über die jahrhundertelang der Pflug gegangen ist, als gäbe es sie nicht, und die sich nur dem Blick aus luftiger Höhe verraten. Geht man nur bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, nicht weiter also als bis zu einer Zeit, in der die letzten weißen Flecken der Weltkarte verschwinden und Rohstoffmärkte, Eisenbahnen und Telegrafen für den modernen innigen Zusammenhang aller Weltteile sorgen, so zeigt sich doch, dass seither weit mehr Länder untergegangen sind als sich haben erhalten können – dreimal, vielleicht sogar fünfmal so viel.
Große Reiche sind darunter, wie die Sowjetunion und das Reich der Osmanen, winzige Splitter wie Tanger und Batum; altehrwürdige, die schließlich zu Grabe getragen werden, wie Österreich-Ungarn, und Eintagsfliegen wie die Republik Hatay; historische Landschaften, die für kurze Zeit ins Licht der Eigenständigkeit treten wie Ingermanland oder die Inseln unter dem Winde, und kurzlebige Kunstgebilde wie das Kaiserreich Mexiko oder das Kaiserreich Mandschukuo (überhaupt pflegen Kaiserreiche die unsichersten Konstruktionen zu sein); wohlbekannte wie die Tschechoslowakei und solche, von denen Sie höchstwahrscheinlich noch nie etwas gehört haben, wie Occussi Ambeno oder Elobey, Annobón und Corisco; vernichtete Staaten, befreite Kolonien, Besatzungsgebiete, abtrünnige Provinzen, Schwindelprojekte, heikle Zwischenzonen und Kompromissbildungen jeder Art.
Eines aber haben alle diese Länder gemeinsam: Sie beglaubigen sich durch ihre Briefmarken. Ihre Armeen zerstoben, ihre Politiker versauerten im Exil, für eine eigene Architektur haben oftmals Zeit und Mittel nicht gelangt. Immer aber haben sie, und wenn sie nur drei Tage währten und drei ratlose Funktionäre zu ihrer Verfügung hatten, den Weg an einen Druckstock gefunden, der ihnen die kleinen gezähnten Zettel auswarf.
Diese kleinen gezähnten Zettel! Beweglicher sind sie als ein Gesandter, luftiger als eine Fahne, einprägsamer als eine Hymne, beredter als ein Kanonenboot. Und dauerhafter als all diese miteinander. Ermöglichung des Briefverkehrs ist ihr Vorwand, wie Tanz der Vorwand der Liebe. Wie kleine Flaggen prangen sie, Abzeichen der Hoheit – denn nur staatliche Hoheit darf sich unterstehen, Briefmarken zu edieren (und wo eine nicht hoheitliche Stelle sich dessen untersteht, da rümpft der »Michel-Katalog«, die Bibel der Sammler, die Nase und spricht von »privater Mache«). Doch sie verraten mehr als Flaggen. Flaggen sind im Grunde langweilig, sie tragen einen Anspruch, aber keinen Ausdruck vor sich her; sie sind Zeichen, aber kein Gesicht.
Briefmarken hingegen, obwohl viel heraldischer Geist in ihren Entwurf eingeht, machen sich los von dieser Starrheit. Und seien sie noch so unbedeutend in ihren Abmessungen, und mag der Londoner Stahlstich sie noch so auf die steife Oberlippe verpflichten, der finster-schwammige Offsetdruck des Stalinismus aufs Kollektiv und die Unzulänglichkeit der heimischen Printtechnik aufs unüberwindlich Lokale: Sie bleiben leibhaftige Bilder. In ihnen gibt ein Land ahnungslos seine Physiognomie preis, sie sind Plappermäuler der Souveränität, die mehr erzählen, als ihrem Auftraggeber lieb ist.
Mit beileibe nicht allen dieser untergegangenen Gebiete hat es ein gutes Ende genommen. Keines wurde ganz freiwillig aufgegeben, und in den Briefmarken mancher von ihnen tritt, kaum verhüllt, der Schrecken der Geschichte hervor. Aber er ist ausgestanden, es ist vorbei mit ihnen. O würde sich nur alles, was die Geschichte hinterlassen hat, so in Wohlgefallen auflösen wie diese kleinen Bilder, die nun verlassen herumliegen wie die Karten eines Spiels, an dessen Regeln sich keiner mehr erinnert!
Die »Verschollenen Länder« verdanken ihre Existenz zwei Serien von Zeitungskolumnen, die in der »Berliner Zeitung« und in der »Süddeutschen Zeitung« abgedruckt worden sind. Ein Vorläufer dieses Buchs ist mit dem gleichen Titel vor 15 Jahren schon einmal erschienen. Unter den 60 Einträgen der vorliegenden Ausgabe wurden 20 aus dem früheren Buch übernommen, 40 aber sind ganz neu, sodass auch, wer noch das alte kennt, hoffentlich genügend Neues findet.
Ich möchte an dieser Stelle allen jenen danken, die mir geholfen haben. Zwei große Philatelisten, Niels Petersen in Chemnitz und mein Bruder Uli, haben mich an ihren so eigenwilligen wie universalen Sammlungen teilhaben lassen; sie haben mir das Wichtigste geschenkt, die Bilder der Briefmarken selbst. Eske Bockelmann hat sie für mich eingescannt. Und meine Lektorin Anne Hamilton hat, wie schon so manches frühere Buch, auch dieses mit geduldiger Ermunterung, Urteilskraft und Humor auf den Weg gebracht. Auch an meinen Großvater denke ich zurück, der meinen Geschwistern und mir vor fast einem halben Jahrhundert, als wir noch Kinder waren, für diese bunten Schätze die Augen geöffnet hat.

Es mag ja eine Fabel sein, dass die Inuit (Eskimo sagt man nicht mehr, so wenig wie Zigeuner und Neger) 200 verschiedene Wörter für Schnee hätten. Aber mit einer gewissen Präzision können sie ihre arktische Lebenswelt schon beschreiben: »Die Oberfläche der Schollen ist eine verwüstete Landschaft aus ivuniq, aus von der Strömung und dem Zusammenstoß der Platten nach oben gepressten Eisstaus, aus maniilaq, Eisbuckeln, und aus apuhiniq, dem Schnee, den der Wind zu harten Barrikaden komprimiert hat. Derselbe Wind, der die agiupinniq gezogen hat, die Schneefahnen, denen man mit dem Schlitten folgt, wenn sich der Nebel auf das Eis gelegt hat.« Auch hikuaq und puktaaq spielen eine gewisse Rolle, zwei weitere Typen von Eisschollen, deren Unterschied zu erläutern hier aber zu weit führen würde.
Nicht zu weit allerdings führt es für Fräulein Smilla, deren besonderes Gespür für Schnee dem Weltbestseller von Peter Høeg aus dem Jahr 1996 den Titel gibt. Dieses Gespür kommt ihr sogar noch in Kopenhagen zugute, wohin es sie wie so viele Grönländer verschlagen hat. Dort erkennt nur sie aus den Spuren, die der kleine Jesaja im Neuschnee auf dem Dach hinterlassen hat, dass er nicht von sich aus gesprungen ist, sondern weil er über irgendetwas zu Tode erschrak. Und so setzt sich die Geschichte in Gang, die Smilla aus der dänischen Hauptstadt nach langen Jahren zurückführt an den Ort ihres Ursprungs.
Fräulein Smilla stammt aus Thule, oder wie es in ihrer Muttersprache heißt: Qaanaaq. Selbst im generell entlegenen und unwirtlichen Grönland stellt es einen besonders unwirtlichen und entlegenen Punkt dar. Das Thermometer kann hier absinken bis auf minus 58 Grad. Wer hier im Freien urinierte (und uriniert wurde immer im Freien), musste eine Decke um sich breiten und die Luft darunter zuvor mit einem Primuskocher erwärmen, sonst froren ihm empfindliche Teile ab. Was nur hatten die Einheimischen getan, bevor der Kontakt mit der westlichen Zivilisation ihnen einen Primuskocher bescherte? Und doch vermochten sie dort zu leben. »Naammassereerpoq«, wie der kleine Jesaja sagt: Man gewöhnt sich an alles.
Thule: Dieses Wort hatte der westlichen Zivilisation immer einen Schauder über den Rücken gejagt. Der Name geht zurück auf den griechischen Seefahrer Pytheas, der im 4. Jahrhundert vor Christus weiter nach Norden vordrang als jeder andere Mensch der Antike. Er sprach davon, mit seinem Schiff bis an den Rand eines »geronnenen Meeres« gelangt zu sein, also wohl eines gefrorenen. Die Griechen waren ja einiges an Fabulierkünsten von ihren Reiseschriftstellern gewohnt – aber das ging eindeutig zu weit! Und doch tauchte der Name durch die Jahrhunderte immer wieder auf, gern mit dem Zusatz »Ultima Thule«: Thule, nach dem nichts mehr kommt, der letzte, extreme Raum, wo sich noch Menschen halten konnten. Ultima Thule, so nennen die Geografen bis heute das nördlichste Stück Land auf dem Globus, immer eine andere, neue Klippe vor der grönländischen Küste, denn im geronnenen Meer lassen sich Fels und Eis schwer unterscheiden. Gretchen im »Faust« singt ihr Märchenlied vom König in Thule; aus Thule ist Prinz Eisenherz gebürtig. Die Thule-Gesellschaft träumte in der Zwischenkriegszeit von einem hochnordischen Atlantis der Arier und übte beträchtlichen Einfluss auf Himmler und die SS aus. Die Amerikaner nannten ihren nördlichsten Luftwaffen-Stützpunkt, 1200 Kilometer jenseits des Polarkreises, Thule. Wer »Thule« in die Suchmaschinen eingibt, dem purzeln Angebote eines Produzenten von Wintersportgerätschaften entgegen.
Das Thule von Fräulein Smilla und unserer Briefmarke aber ist das geheimnisvollste von allen. Denn hier kam ein Bodenschatz vor, den es nur hier gab: Kryolith. Schon der Name weckt Assoziationen von Seltenheit und Gefahr. Kryolith verbindet die griechischen Wörter für Stein und Frost; und genau so, glasig und von einer milchigen Weiße, sah der Stoff auch aus, wie Eis, das unter dem ungeheuren Druck der Gletscher einen höheren Grad von Festigkeit erlangt hatte. Es erwies sich als unentbehrlich bei der Produktion von Aluminium. Thule mit seinen arktischen Bergwerken besaß das Weltmonopol auf diesen Froststein. Seiner Abgeschiedenheit wegen erhielt es eine eigene Post mit eigenen Marken zugebilligt. Erleichterten diese schönen, originellen, obwohl sehr kühlen und gleichsam mit frostklammer Hand entworfenen Postwertzeichen die Kontrolle der Kommunikation? Peter Høegs Roman gibt zu verstehen, dass alles, was mit Thule zusammenhing, der Zensur, Vertuschung, Geheimhaltung unterworfen war. Fräulein Smilla hat es mit einer dicht gewobenen Verschwörung zu tun.
Was wohl seither mit den Leuten von Thule geschehen ist? Ich weiß es nicht. Schon in Høegs Buch häufen sich die Zeichen des Verfalls. Die einstmals freien Robbenjäger, die von einer sozialdemokratischen Politik als »Norddänen« zur Sesshaftigkeit gezwungen werden sollen, begehen Selbstmord, so Smillas Bruder, oder verschwinden einfach im Eismeer, so Smillas Mutter. Und was ist mit Smilla selber? Sie hat sich jedenfalls entschlossen, keine Kinder zu haben. Das Buch schließt: »Erzähl uns, werden sie kommen und zu mir sagen. Damit wir verstehen und abschließen können. Sie irren sich. Nur was man nicht versteht, kann man abschließen. Die Entscheidung bleibt offen.«

Sie wissen sicherlich, was ein Palindrom ist: ein Satz, der von vorn wie von hinten gelesen das Gleiche ergibt, z. B.: »A man, a plan, a canal: Panama.«
Der Mann war Theodore Roosevelt; der Plan bestand darin, den Isthmus von Panama unter den Auspizien der USA zu durchstechen; und zur Rechtfertigung seines Projekts hielt er einen Satz wie diesen für völlig ausreichend. Die abgebildete Briefmarke – einige Jahrzehnte nach jener unbeschwerten Pionierzeit gedruckt – leistet schon etwas mehr Argumentationsarbeit: »The Land Divided – the World United« ist hier als Motto des Kanalwappens zu lesen.
Tatsächlich hatten die USA nicht nur ein Land geteilt, um ihren Kanal zu erhalten, sondern gleich zwei. Panama war ein Bestandteil Kolumbiens; als sich aber das kolumbianische Parlament einen bereits unterzeichneten Vertrag, der den USA freie Hand auf dem Isthmus gegeben hätte, zu ratifizieren weigerte, da ermunterten die USA eine örtliche Revolte. Im November 1903 erklärte sich die bisherige Provinz Panama für unabhängig, wurde unverzüglich von den Vereinigten Staaten anerkannt und gewährte diesen ebenso postwendend den gewünschten Vertrag, in dem ihnen die Hoheitsrechte über den zu bauenden Kanal und einen Saum von acht Kilometern Breite zu beiden Seiten eingeräumt wurde. Der neue Staat wurde so gleich zu Beginn in zwei separate Hälften zerlegt und verzichtete auf jeden Einfluss auf die Kanalzone und ihre Nutzung. Er beklagte sich nicht: Denn nur zu diesem Zweck war er schließlich ins Leben gerufen worden. Am 15. August 1914 fuhr das erste Schiff durch den neuen Kanal – ein Ereignis, das damals in Europa, das andere Sorgen hatte, fast nicht zur Kenntnis genommen wurde.
Verwaltet wurde die Kanalzone von der Panamakanal-Gesellschaft, deren Aufsichtsrat das amerikanische Verteidigungsministerium ernannte; einziger Gesellschafter war die US-Armee. Die Vereinigten Staaten hatten nämlich noch einen zweiten Verwendungszweck für dieses Territorium gefunden: als Militärstützpunkt und Trainingsgelände für die Elitetruppen befreundeter Staaten, die hier besonders den Häuser- und Dschungelkampf erlernten; 42 Prozent der Fläche in der Kanalzone war oder ist militärisch genutzt.
Die Präsenz der USA, die so fühlbar ins Fleisch der Souveränität schnitt, wurde in Panama und anderen Ländern der Region zunehmend als Provokation empfunden. Schließlich lenkte der Demokrat Jimmy Carter ein und handelte einen neuen Kanalvertrag aus, der den alten, »ewigen« ersetzte und die schrittweise Übertragung des Kanals an Panama bis zum Jahr 2000 vorsah. Die republikanischen Präsidenten, die ihm folgten, zeigten beim Abzug indes keine Eile. George Bush stellte die Verhältnisse klar, als er 1989 aus der Kanalzone heraus Panama angriff und dessen amtierenden Präsidenten, Manuel Noriega, wie einen gewöhnlichen Kriminellen jagte, stellte und vor ein US-Gericht brachte.

Im Weißen Pferd zu Milbenau sitzen sie zusammen, die Männer und die Mümmelgreise mit ihren langstieligen Pfeifen und schlafmützenartigen Kopfbedeckungen und politisieren, teils ängstlich, teils empört, aber einig in der Grundfrage: »Kreuzhimmel-tausenddonnerwär,/uns’ olle König mot weer her!!«
Der olle König, den die Stammtischrunde in Wilhelm Buschs »Der Geburtstag oder die Separatisten« meint, ist Georg V. von Hannover, der blinde König Georg – die Briefmarke deutet sein Gebrechen behutsam durch das schwere Lid und den vergrößerten Tränensack an. Er war der zweite König, seit Hannover im Jahre 1837 seine mehr als 100 jährige Personalunion mit Großbritannien aufgekündigt hatte, weil es die weibliche Erbfolge, die Thronbesteigung der Prinzessin Victoria, nicht akzeptieren wollte. In den 29 Jahren seiner eigenstaatlichen Existenz bewies das Königreich keine glückliche Hand, weder nach innen noch nach außen. Es begann sein Dasein, indem König Ernst August die Verfassung aufhob, die »Göttinger Sieben«, die dagegen protestierten, angeführt von den Brüdern Grimm, aus ihren Professuren verjagte und die Empörung des gesamten liberalen Deutschlands erregte.
Sein ebenso erzkonservativer Nachfolger Georg verärgerte nicht nur das Bürgertum, sondern stieß auch seinen mächtigsten und bedenklichsten Nachbarn, Preußen, durch Unnachgiebigkeit vor den Kopf. Obwohl Hannover zwischen den preußischen Kernlanden im Osten und den rheinisch-westfälischen Gebieten Preußens im Westen wie in einen Schraubstock eingezwängt lag, kam es, nach einem missglückten Versuch der Neutralität, im Krieg von 1866 auf die Seite Österreichs zu stehen. Das Ergebnis konnte niemanden überraschen: Bismarck ergriff mit Freuden die Gelegenheit, eine Landbrücke zwischen den beiden bislang getrennten Teilen Preußens zu bauen, vertrieb den König ins Exil und errichtete die Provinz Hannover. (Den sogenannten Welfenschatz, der dem Herrscherhaus gehört hatte, strich Bismarck in seine Privatschatulle ein und benutzte ihn später z. B., um dem bayerischen König den Bau seiner Schlösser zu finanzieren, womit er ihm den Beitritt zum Reich schmackhaft machte.)
Die Revolte der königstreuen Bauern in Buschs Bildergeschichte beschränkt sich schließlich darauf, ihrem blinden vertriebenen König etwas zum Geburtstag zu schenken. Aber ach, selbst das wird vereitelt: Die Kiepe voll Branntwein Marke »Busenfreund« wird vom betrunkenen Fritze Jost in den Dorfteich gekippt, zum Gaudium der Gänse und Schweine; der Wagen mit den Eiern fällt von der Brücke, so dass die Ehrenjungfern »in Dotter merklich eingehüllt« werden; die aus Butter vom Bäckermeister Knickebieter geformte Statue einer Henne – schon vorher vom Künstler etwas im Umfang verringert (»Und, da das Ganze ein Symbol,/So kann’s nicht schaden, wenn es hohl«) – gerät unter das Gesäß des Kutschers. Zum Schluss sitzen alle, wie zu Anfang, wieder am Stammtisch und genehmigen sich einen Köhm.
Und wie hat der hannoversche Untertan Busch sich zum Sturz seines Landesvaters gestellt? Das ist nicht so leicht zu sagen. Im Proömium, das er seiner Geschichte voransetzt, mischen sich Furcht vor dem Neuen, gemütlicher Rückzug ins Private, Zerknirschung über den eigenen »Hochverrat« und der Zynismus des »bösen Menschen«, der da denkt: »Na, die hat’s erwischt!« 20 Jahre zuvor hatte die Aufregung noch zur Revolution gereicht; jetzt langt es nur noch zu einer kräftigen Prise aus der Tobaksdose.

Folgender Aufruf ging im August 1968 durch die deutschen Zeitungen: »Jedermann weiß es oder kann es wissen: Der Bürgerkrieg in Biafra ist zum Völkermord gesteigert worden. Die Blockade verursacht täglich den Hungertod von mehreren tausend Zivilisten, hauptsächlich Kindern. Die Ausrottung von acht Millionen Ibos steht bevor. In wirtschaftlicher und machtpolitischer Konkurrenz fördern west- und osteuropäische Staaten ein Verbrechen. West und Ost werden an Biafra scheitern, wenn sie dem Begriff Koexistenz nicht durch gemeinsame Hilfe einen humanitären Sinn geben. Die Not in Biafra fordert alle zur Entscheidung.«
Im August 1968 war Deutschland ja eigentlich ziemlich stark mit sich selbst beschäftigt und höchstens noch mit seinem tschechoslowakischen Nachbarn, wo gerade die sowjetischen Panzer einrollten. Aber dieser Aufruf, unterzeichnet von Marion Gräfin Dönhoff, der Herausgeberin der »Zeit«, dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch und dem deutschen Schriftsteller Günter Grass, drang dennoch durch. Ich war damals acht Jahre alt, doch ich erinnere mich lebhaft an das allgemeine Entsetzen, das die Bilder von Kindern auslösten, deren Beine wie Stengel und deren Bäuche wie Trommeln wirkten, mit Nabeln, die darüber hinaus noch einmal halbkugelig vorquollen, Haut und Haare von einer absurden Kupferfarbe und die Augen unglaublich groß. Wer so aussah, dem war nicht mehr zu helfen, das war klar, der hatte nur noch Tage, vielleicht Stunden zu leben. Im »Biafra-Kind« fand das Schicksal Afrikas seinen in den Augen der Welt bis heute wirksamen katastrophalen Ausdruck.
Doch helfen wollten alle. Ein Hamburger Rentner spendete 4000 Mark, sein gesamtes Vermögen. Selbst der Playboy Gunter Sachs veranstaltete im fernen Sylt ein Benefiz-Fußballspiel. Allein, es erwies sich als sehr schwierig, die eingesammelte Hilfe auch an Ort und Stelle zu schaffen. Denn Ursache dieser Hungersnot war eine Blockade.
Wie konnte es dazu kommen? Als Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, 1960 seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft erlangte, war man sich einig: Zustände wie im Kongo, der in Krieg und Anarchie zerfiel, seien in diesem gut organisierten Land nicht möglich. Aber es wurde noch schlimmer.
Der junge Staat umfasste Völkerschaften, die sich zwischen Savanne und Regenwald verteilten, 500 verschiedene Sprachen hatten und teils Muslime, teils Christen waren oder ihren alten lokalen Religionen anhingen. Die Gegensätze konnten nicht größer sein. Jedes Volk hatte das Gefühl, sich der Übervorteilung durch die anderen notfalls mit Gewalt erwehren zu müssen. Nach einer Serie von Putschen und Gegenputschen im Jahr 1966 wurden im ganzen Land Angehörige des südöstlichen christlichen Volks der Ibo gejagt, zwei Millionen von ihnen flohen zurück in ihre alte Heimat. Eine neue Aufteilung der nigerianischen Bundesstaaten sollte ihr Gebiet vom Nigerdelta trennen, wo es Erdöl gab, die wichtigste Einnahmequelle des ganzen Landes.
Da entschieden die Ibo sich zur Sezession. Der Militärkommandant der Region, Oberleutnant Chukwuemeka Odumegwo Ojukwu, rief am 30. Mai 1967 die Republik Biafra aus; die Ölquellen sollten selbstverständlich dazugehören. Die Reaktion des nigerianischen Zentralstaats ließ nicht lange auf sich warten. In zwei Speerspitzen stießen nigerianische Truppen über den Niger nach Biafra vor. Doch Biafra, das so gut wie keine ausgebildeten Streitkräfte hatte, das seine Rekruten in dreiwöchigen Crash-Kursen mit Stöcken exerzieren ließ (Gewehre waren Mangelware) und über genau zwei veraltete Militärflugzeuge verfügte, schlug sich unerwartet gut. Nach einem Jahr Krieg bestand die Republik immer noch. Am 18. Mai 1968 fiel jedoch Port Harcourt, Biafras einziger Hafen. Von nun an sperrte Nigeria alle Importwege auf dem Land, und aus der Luft lässt sich keine komplette Bevölkerung ernähren. Das Rote Kreuz stellte die Arbeit ein, nachdem mehrere seiner Versorgungsflugzeuge abgeschossen worden waren.
Trotzdem hielt Biafra, dessen unbesetztes Territorium zusehends schrumpfte und das zweimal vor dem anrückenden Feind die Hauptstadt wechseln musste, noch bis zum Januar 1970 aus. Über die Zahl der Toten durch Kämpfe, Massaker und Unterernährung gibt es bis heute keine verlässlichen Zahlen, die meisten Schätzungen gehen von einer bis zwei Millionen aus, ein rundes Zehntel der Bevölkerung. Das Land war weitgehend zerstört, es wurde unter Militärverwaltung gestellt, Angehörige des Volks der Ibo für Jahrzehnte nicht in Verwaltung und Armee zugelassen. Die Versöhnung, zu der Nigerias Präsident Yakubu Gowon nach dem Sieg aufrief, fand nicht statt.
Aber es ist auch etwas Positives bei diesem Krieg herausgekommen. Bernard Kouchner, damals Aktivist vor Ort, hatte die Ohnmacht der offiziellen Hilfsorganisationen erlebt, besonders des quasi regierungsamtlichen Roten Kreuzes, das sich auf Absprachen mit der Staatsgewalt einlassen musste, die fast einer passiven Mittäterschaft gleichkamen. Hier musste etwas Neues ins Leben gerufen werden, eine Einrichtung, die sich von Staaten nichts sagen ließ und selbst entschied, wo und wie zu helfen sei. So gründete er, mit seiner Biafra-Erfahrung im Rücken, die »Médecins Sans Frontières«, die Ärzte ohne Grenzen.