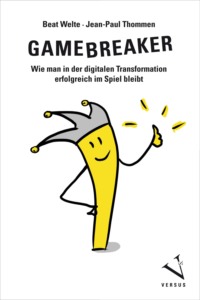Czytaj książkę: «Gamebreaker»

Beat Welte · Jean-Paul Thommen
GAMEBREAKER
Wie man in der digitalen Transformation erfolgreich im Spiel bleibt
Illustration
Achim Schmidt
Versus • Zürich
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Weitere Informationen über Bücher aus dem Versus Verlag unter
© 2019 Versus Verlag AG, Zürich
Umschlagbild und Illustration:
Achim Schmidt · Mainz · www.business-playground.com
Satz und Herstellung: Versus Verlag · Zürich
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim · www.brocom.de
ISBN 978-3-03909-262-8 (Print) ISBN 978-3-03909-762-3 (E-Book)
Inhaltsverzeichnis
 1 Suchen, wo der Schlüssel liegt
1 Suchen, wo der Schlüssel liegt
 2 Der verlorene Kunde
2 Der verlorene Kunde
 3 Es muss nicht immer Disruption sein
3 Es muss nicht immer Disruption sein
 4 Der große Digitalisierungsschock
4 Der große Digitalisierungsschock
 5 Von Heizern und Gamebreakern
5 Von Heizern und Gamebreakern
 6 Wie Manager Gamebreaking fördern können
6 Wie Manager Gamebreaking fördern können
 7 Gamebreaking und Fakebreaking
7 Gamebreaking und Fakebreaking
 8 Kultur isst Strategie und Struktur
8 Kultur isst Strategie und Struktur
 9 Sieben Schritte zum erfolgreichen Gamebreaker
9 Sieben Schritte zum erfolgreichen Gamebreaker
Schritt 1: Die Analyse
Schritt 2: Die Vision
Schritt 3: Die radikale Kundenperspektive
Schritt 4: Die bewusste Entscheidung
Schritt 5: Das permanente Denken und Handeln
Schritt 6: Die Mitspieler
Schritt 7: Die Stolpersteine
 10 Gamebreaker – kurz und bündig
10 Gamebreaker – kurz und bündig
Fallbeispiele
Fall 1: Krone aus dem Drucker – Gamebreaker in der Zahnarztpraxis
Fall 2: «Harvard für alle» – Gamebreaker im Bildungswesen
Fall 3: Der digitale Anlageberater – Gamebreaker in der Vermögensverwaltung
Anmerkungen
Literatur
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Firmen- und Markenverzeichnis
Die Autoren
1 Suchen, wo der Schlüssel liegt

Der österreichische Psychologe und Autor Paul Watzlawick erheitert in seinem Buch «Anleitung zum Unglücklichsein» mit der Geschichte des Betrunkenen, der unter einer Straßenlaterne seinen verlorenen Schlüssel sucht. Ein Polizist hilft ihm bei der Suche. Als der Polizist nach langem und erfolglosem Suchen wissen will, ob der Mann sicher sei, den Schlüssel hier verloren zu haben, antwortet jener: «Nein, nicht hier, sondern dort hinten – aber dort ist es viel zu finster, um den Schlüssel zu suchen.»
Ein Witz, natürlich – nur verhalten sich auch viele Unternehmen genau so wie der Betrunkene in der Geschichte. Zwar wird messerscharf analysiert, dass die allgemeine Veränderungsgeschwindigkeit als Folge der Digitalisierung stark zugenommen hat und dass Geschäftsmodelle durch Technologiesprünge heute innerhalb von Monaten (statt Jahren oder Jahrzehnten) obsolet werden. Nur gestehen sich insbesondere viele Großunternehmen kaum ein, was die daraus zu ziehende Konsequenz wäre: nicht (nur) die Optimierung des bestehenden Geschäftsmodells, sondern das radikale Infragestellen dieses Geschäftsmodells. Und dies mit allen Konsequenzen: sich selbst disruptieren, um nicht disruptiert zu werden. Dazu wäre die systematische Nutzung sämtlichen Wissens und Könnens im Unternehmen voranzutreiben, nämlich das Wissen, das in den Köpfen der Mitarbeitenden steckt. Das radikale Infragestellen des Geschäftsmodells, das Reflektieren über zugrunde liegende Annahmen sowie die Bereitschaft, etwas Grundlegendes zu ändern, ist die höchste Form des «Gamebreaking». Dieses Gamebreaking ist sowohl auf Stufe des Unternehmens, aber auch von jedem einzelnen Mitarbeitenden zunehmend gefragt. Denn nur dieses Gamebreaking stellt langfristiges Überleben sicher.
Dieses Buch richtet sich primär an jene fünfzig Prozent der berufstätigen Bevölkerung, deren Arbeitsstellen in den nächsten Jahren durch die fortschreitende Digitalisierung bedroht sein werden (siehe Kapitel 4 «Der große Digitalisierungsschock» auf Seite 37). Ihr Blick auf die Folgen der Digitalisierung für ihre Tätigkeit wird mit diesem Buch geschärft. Sie erhalten ein Frühwarnsystem, mit dem sie erkennen können, ob sie betroffen sind oder nicht. Und sie lernen ein Instrumentarium kennen, mit dem sie sich beruflich neu erfinden und die Digitalisierung als Chance nutzen können, denn die digitale Transformation schafft auch viele neue Arbeitsplätze und bietet große Chancen zur persönlichen Veränderung. Aber auch Führungskräfte und Mitglieder von Geschäftsleitungen werden dieses Buch nützlich finden: Sie müssen nicht nur sich selbst im Digitalisierungssturm neu erfinden, sondern auch ihr Unternehmen in einer hochdynamischen Umgebung so navigieren, dass es trotz neuer und teilweise aus ungewohnter Richtung kommender Konkurrenten langfristig überleben kann. Eigenes Gamebreaking-Verhalten sowie der Aufbau einer Gamebreaking-Kultur im Unternehmen sind der Königsweg dazu.
 Was ist Gamebreaking?
Was ist Gamebreaking?
Der Begriff «Gamebreaker» wird im angelsächsischen Sprachraum überwiegend im Bereich Sport gebraucht und dort vor allem im Eishockey. Er bezeichnet eine Person, die einen signifikanten Beitrag zum sportlichen Erfolg leistet. Also jemand, der in der Lage ist, das Spiel zu «drehen» und seinem Team zum Erfolg zu verhelfen: etwa durch einen persönlichen, außerordentlichen Effort, eine geniale Idee, einen Geistesblitz oder die mitreißende Art und Weise seines Spiels. Kurz: durch außerordentliches Denken und Handeln.
Ähnlich wird «Gamebreaking» in diesem Buch verstanden: Es ist eine Geisteshaltung, die schwierigen Situationen nicht mit dem «Mehr-desselben-Prinzip» begegnet, sondern mental einen Schritt zurückgeht und fragt: Was hat sich verändert? Wie muss ich mich und mein Verhalten verändern, um erfolgreich zu sein? Welche lieb gewonnenen Verhaltensweisen muss ich aufgeben? Welche Fakten, Werte und Meinungen sowie eingespielte Verhaltensweisen sind zu revidieren? Wie muss ich meine Wahrnehmung der Wirklichkeit ändern, um erkennen zu können, welche Lösungswege auch – und vielleicht besser, eleganter, schneller, effizienter – zum Ziel führen? Dazu braucht es eine Geisteshaltung, um buchstäblich aus der Komfortzone des durch die Lampe hell erleuchteten Bodens herauszutreten und dort zu suchen, wo es ein bisschen dunkler, schwieriger und ungewisser ist. Aber genau dort, wo letztlich der Schlüssel zum Erfolg liegt.
Radikale Gamebreaker optimieren ihr Spiel nicht nur, sondern sie definieren die Regeln neu. Sie disruptieren ein bestehendes Spiel. Gamebreaker sind dabei nicht nur die großen, vielfach beschriebenen Erfinder und Unternehmensführer der Wirtschaftsgeschichte. Digitalisierung und Automatisierung werden von uns allen in Zukunft nicht nur lebenslanges Lernen erfordern, sondern auch eine neue Geisteshaltung: den Willen und die Fähigkeit, Veränderungen wahrzunehmen und unser Verhalten nach Maßgabe dieser Veränderungen anzupassen, Vertrautes aufzugeben und neue Chancen zu packen.
Ziel dieses Buches ist es, Gamebreaking als erfolgversprechende Kultur des digitalen Wandels darzustellen und insbesondere für Unternehmensführer und Vorgesetzte Wege für den Kulturwandel in Unternehmen und für jeden Einzelnen aufzuzeigen.

Gamebreaking kann unangenehm und hart sein. Denn der Mensch strebt intuitiv nach «mehr desselben», also alles so zu machen, wie er es schon immer gemacht hat, aber einfach ein bisschen intensiver, denn das vermittelt das Gefühl der scheinbaren Sicherheit und des scheinbaren Erfolgs. Ein Ertrinkender rudert hektisch mit den Armen, um sich gegen den drohenden Untergang zu wehren, und er klammert sich umso verzweifelter an den Rettungsschwimmer, je bedrohlicher seine Lage wird, was seine Überlebenschancen ganz im Gegenteil reduziert. Bezeichnenderweise haben solche Verhaltensweisen genau dann Konjunktur, wenn gerade «weniger desselben» gefragt wäre. Also zum Beispiel, wenn Schlagzeilen über die «digitale Revolution» dominieren – und viele Unternehmensführer ratlos lassen, was dies nun eigentlich für das eigene Unternehmen heißt. Beim Ertrinkenden ist das Scheitern des «Mehr-desselben-Prinzips» (also wildes Rudern) offensichtlich – in der Wirtschaft ist es, wenn auch weniger augenfällig, nicht anders.
Die letzte Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts wird gemeinhin als Startschuss für die digitale Revolution gesehen – die «Persönlichen Computer» werden für jedermann erschwinglich und verbreiten sich schnell in Haushalten und Unternehmen. Parallel dazu wird das der militärischen Nutzung vorbehaltene Arpanet zum kommerziell wie auch privat nutzbaren Internet, und das Metcalfe’sche Gesetz, ursprünglich definiert für lokale Netze, kommt im global nutzbaren Internet in einer überwältigenden Art und Weise zum Tragen: Der Nutzen nimmt mit steigender Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Kosten überproportional zu. Und dieses Nutzenpotenzial ist gigantisch.
Die Digitalisierung führt über die Zeit zu einer stark erhöhten Veränderungsgeschwindigkeit. Durch den Plattformansatz (siehe dazu Seite 54) und die Cloud-Technologie (siehe dazu Seite 30) lassen sich neue Geschäftsmodelle sehr schnell umsetzen – und die Grenzkosten, einen neuen Kunden zu betreuen, streben dabei gegen null.
Unternehmen sehen sich zu Recht herausgefordert – und reagieren wie der Ertrinkende: nicht weniger Bürokratie, sondern mehr. Nicht kleiner, agiler, marktorientierter, sondern größer, schwerfälliger und zentralistischer. Denn das sich in den neunziger Jahren durchsetzende Mantra der Betriebswirtschaftslehre lässt sich mit drei Buchstaben beschreiben: BPR – Business Process Reengineering. Salopp gesagt und in Abwandlung des Johannesevangeliums: Am Anfang steht der zentral definierte und gesteuerte Prozess. Alle Dinge sind durch denselben gemacht, und ohne denselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. Gleichzeitig wird ein enormer Steuerungs- und Überwachungsapparat aufgebaut, um sicherzustellen, dass der für alle und überall geltende Prozess («one size fits all») auch akribisch befolgt wird. Natürlich gab es noch einige andere Managementlehren, wie etwa Total Quality Management oder Lean Management, aber keine hatte so fundamentale Auswirkungen wie die Prozessmanie. «Prozess» und die später popularisierte «Compliance» – also die Regelkonformität – sind die beiden Begriffe, die bei Mitarbeitenden in Großunternehmen heute je nach Temperament ein Schaudern oder gequälte Resignation hervorrufen.
Eingeführt haben das BPR-Konzept die beiden Autoren Michael Hammer und James Champy. Unter BPR verstehen sie das fundamentale Überdenken und die radikale Neugestaltung des gesamten Unternehmens oder zumindest der wesentlichen Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht dabei – zumindest theoretisch – der Kunde und dessen Wünsche. Fokussiert wird auf die unternehmerischen Kernprozesse, die konsequent auf die Kundenbedürfnisse auszurichten sind. Der stark ausgebauten Informationstechnologie kommt die Rolle zu, die Prozesserfüllung effektiv und effizient zu unterstützen: Prozesse werden in IT-Systemen abgebildet und ausgeführt.
Mit der Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse hatte BPR im Prinzip die richtige Stoßrichtung. In der Praxis gaben indes weniger die Kundenbedürfnisse, sondern der Prozess als solches als oberstes Mantra die Marschrichtung vor, und das hat Folgen, die bis heute nachwirken. Die prozessorientierte Organisationsgestaltung wurde insbesondere von global operierenden US-Unternehmen zum kritischen Erfolgsfaktor propagiert im sich verschärfenden globalisierten Wettbewerb. Die Verlockung, die gesamten Aktivitäten in Prozessen zu beschreiben, diese zu dokumentieren und die gesamte Belegschaft darauf zu trimmen, die Prozesse akribisch zu «executen», hat etwas Bestechendes: Das Unternehmen erscheint als gut geölte Maschinerie mit vielen, einfach zu ersetzenden und kostengünstigen Einzelteilchen, insbesondere die leicht austauschbaren Mitarbeitenden, die zentral prozessgesteuert und aus dem Unternehmensolymp überwacht ihrer Aufgabe nachkommen. So tut die Maschine genau das, wofür sie konstruiert wurde: Sie ist effizient, birgt keine großen negativen Überraschungen – aber sie ist über die Zeit nicht mehr effektiv, denn die Anforderungen verändern sich, die Maschine aber passt sich den Veränderungen nicht an.
Der Untertitel der Reengineering-Bibel von Hammer und Champy lautet zwar «A Manifesto for Business Revolution», doch der Untertitel täuscht: Denn es geht um alles andere als eine Revolution, sondern schlicht um eine massive Steigerung der betrieblichen Effizienz. Oder um im Bild der Maschine zu bleiben: Sie tut nach wie vor das, was sie tun soll, nur etwas effizienter. Sobald das Prozesskorsett über das Unternehmen gestülpt ist, fällt es dem Unternehmen immer schwerer, etwas völlig anderes zu tun. Es kann sich der dynnamischen Umwelt immer weniger anpassen. Die Fähigkeit, hochgradig zuverlässig und vorhersehbar zu sein, hat einen hohen Preis: positive Überraschungen und Anpassungsleistungen bleiben aus. Wenn eine Geschäftsleitung in Prozessen und in Prozessoptimierung denkt, dann sind große unternehmerische Würfe eher selten.
Das Unternehmen verhält sich wie ein Verdurstender in der Wüste, der die Orientierung verloren hat und im Kreis geht – und dies immer schneller. Denn das zugrunde liegende Maschinenmodell beruht auf einem relativ einfachen Baukastenprinzip mit monokausalen Ursache-Wirkungs-Annahmen (schneller gehen = schneller ans Ziel kommen). Diese simple Vorstellung des Unternehmenssystems war – wenn überhaupt – noch zu Zeiten eines Tante-Emma-Ladens hilfreich. In hochdynamischen, komplexen Marktsituationen und globalen, vielfach verwobenen Unternehmenssystemen taugt es indes nur beschränkt: Wenn alle Großunternehmen in einen BPR-Wettlauf verfallen, dann wird jenes kurzfristig Vorteile haben, das dies am geschicktesten anstellt. Unter Blinden ist der Einäugige König – gerade in den im Quartalsdenken verhafteten Großunternehmen ist dies von entscheidender Bedeutung.
Heute, da viele Großunternehmen brutal disruptiert worden sind, wird immer offensichtlicher, dass dieses Maschinenmodell und die den Mitarbeitenden zugedachte mechanistische Rolle in einem ganz wesentlichen Aspekt versagen: Das Unternehmen kann sich nicht dynamisch auf die immer schneller wechselnden Marktsituationen einstellen – etwa auf neue Kundenwünsche oder neue Mitbewerber aus fremden Branchen. Und das ist fatal, denn die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit erfordert eine hohe Anpassungsfähigkeit selbst im unternehmerischen «Pflichtteil». Dieser «Pflichtteil» lässt sich als «Management 1. Ordnung» beschreiben, also Handeln innerhalb vorgegebener Strukturen, Prozesse und Spielregeln: Das ist Arbeiten im System.1 BPR adressiert ausschließlich die Optimierung im Management 1. Ordnung, tut dies aber auf eine sehr schwerfällige Art und Weise, die der zunehmenden Marktdynamik nicht gerecht werden kann.
Die Grenzen der Prozess-Revolution zeigt fünfzehn Jahre später der Ökonom Eric D. Beinhocker auf:2 Das Konzept der Evolution sei nicht auf die Biologie beschränkt, sondern sei ein Algorithmus für die Innovation ganz generell und damit auch auf die Wirtschaft anzuwenden. Allerdings stelle sich das Problem, dass die Märkte beziehungsweise die wirtschaftliche Veränderung gerade in der heutigen Zeit hoch dynamisch sei – die meisten Unternehmen aber ganz und gar nicht. Ähnlich wie in der evolutionären Entwicklung der Natur sterben damit Unternehmens-Dinosaurier aus – sie werden von der wirtschaftlichen Evolution ausradiert, ohne die Chance, sich anpassen zu können.
| Aus der Praxis | Wenn Branchenführer scheitern |
Die Digitalisierung erhöht die Veränderungsgeschwindigkeit in atemberaubendem Maße, stellt hohe Anforderungen an die Unternehmen und macht auch vor scheinbar unbestrittenen Branchenführern nicht halt. Ein bekanntes Beispiel ist Nokia. Anfang dieses Jahrhunderts war Nokia praktisch ein Synonym für die Mobiltelefonie. Noch 2005 sah das Unternehmen kein Problem in der Übernahme des Betriebssystems Android durch Google und optimierte weiter munter im System – und ignorierte die fundamentalen Marktveränderungen, die ein Arbeiten am System nahegelegt hätten, frei nach Mark Twain: «Nachdem sie das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten sie ihre Anstrengungen.» 2013 mussten die Finnen ihr serbelndes Handy-Geschäft an Microsoft verkaufen. Doch selbst die geballte Marktmacht des Softwareriesen half nichts – Android-basierte Mobilgeräte und iPhones von Apple dominieren heute den Markt. Dauerte es bei Nokia noch mehr als zehn Jahre, um den Branchenführer zu entmachten, dreht sich das Karussell heute wesentlich schneller. Noch werden Uber und Airbnb als Paradebeispiele für disruptive Geschäftsmodelle gefeiert, doch schon laufen sie Gefahr, selbst beiseitegefegt zu werden: Denn wer braucht schon diese milliardenschweren Unternehmen, wenn die Blockchain-Technologie den an der Transaktion Beteiligten die direkte Abwicklung erlaubt?

Somit zeigt sich ein noch sehr viel größeres Defizit: Das Konzept der Evolution erfordert nicht nur eine hohe Anpassungsfähigkeit beim Arbeiten im System, was mit dem BPR-Maschinenmodell kaum zu leisten ist. Gefragt wäre darüber hinaus auch ein Arbeiten am System, um in der grausamen Evolutionsdynamik überleben zu können, in der die Schwachen und Langsamen gnadenlos weggefegt werden. Das Arbeiten am System, auch als «Management 2. Ordnung» bezeichnet, ist intellektuell und emotional enorm anspruchsvoll, denn hier geht es um das grundsätzliche Reflektieren über das eigene Geschäftsmodell. Es geht um nicht weniger als die Fähigkeit, sich selbst und die eigene Existenzberechtigung im Hinblick auf veränderte Markt- und Kundenerfordernisse in Frage zu stellen – und allenfalls die notwendigen fundamentalen Schlüsse zu ziehen und tiefgreifende Veränderungen einzuleiten. Das ist offensichtlich meilenweit von der im BPR propagierten Prozessoptimierung entfernt, bei der es ausschließlich darum geht, irgendeine Arbeit auf eine bestimmte Art oder ein bisschen anders zu erledigen.

Diese Herausforderung gilt aber nicht nur für Unternehmen, sondern auch – wie noch zu zeigen sein wird – für jeden Einzelnen von uns. Denn Unternehmen und Mitarbeitende sind untrennbar miteinander verbunden: Ein Unternehmen als Ganzes wird diese Arbeit am System kaum erbringen können, wenn es die Mitarbeitenden zu mechanistischen «Prozesserfüllern» degradiert. Mitarbeitende wiederum werden es in einer auf Gehorsam und rigide Prozesserfüllung geprägten Kultur schwer haben, im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches über das System nachzudenken und zu Gamebreakern zu werden – weil dies weder gewünscht noch belohnt wird.
Für Unternehmen wie auch für jeden Einzelnen von uns ist es enorm anspruchsvoll, eine solche Geisteshaltung – also die Geisteshaltung des «Gamebreaking» – mit der entsprechenden Veränderungsbereitschaft aufrechtzuerhalten, denn Unternehmen wie auch Individuen streben nach Routine und Sicherheit. Zwar ist «Change», also der «Wandel», ein sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik hochgehaltenes und positiv konnotiertes Schlagwort, aber ein angelsächsisches Sprichwort entlarvt diesen Mythos treffend: «The only one who wants to have change is a wet baby.»
Denn Unternehmen wie Menschen fühlen sich sehr viel weniger bedroht, wenn sie nur Vorgaben erfüllen oder über eine simple Prozessoptimierung nachdenken müssen als wenn sie sich selbst in Frage stellen sollen. Nur ist es gerade diese notwendige unternehmerische Herausforderung, das «Out-of-the-Box Thinking», welches Unternehmen das langfristige Überleben ermöglicht. Genau diese Herausforderung ist mit der Bedrohung durch die Digitalisierungswelle wesentlich wichtiger geworden – und wurde von der Prozessmanie in den Hintergrund gedrängt.
Die Fixierung auf den Prozess lenkt auch nur allzu oft vom eigentlichen Unternehmenszweck ab: den Kunden einen Mehrwert zu erbringen. Wenig überraschend ist als Folge davon das Leben auch für sehr große und etablierte Unternehmen in den letzten Jahren härter geworden. Die Digitalisierung gewinnt zunehmend an Breite, Tiefe und Schnelligkeit. Einer Studie des Forschungsinstitutes Innosight zufolge schrumpft die Lebenserwartung der größten, im Index S&P abgebildeten US-Unternehmen bedenklich: Betrug die Lebenserwartung 1964 stolze 33 Jahre, reduzierte sie sich 2016 auf 24 Jahre und wird 2027 noch ganze 12 Jahre betragen.3
Ganz offensichtlich befinden wir uns heute in einer Phase, in der sich die Veränderungsgeschwindigkeit so sehr erhöht hat, dass Optimierungen im System ein langfristiges Überleben nicht mehr garantieren. Auf die Erhöhung der allgemeinen Veränderungsgeschwindigkeit reagieren die meisten Unternehmen – neben der immer rigideren Prozessorientierung – mit dem Abbau von Kosten durch Offshoring, der Optimierung der Steuerbelastung oder ähnlichen Maßnahmen. Das ist gut nachvollziehbar – denn das Arbeiten im System ist in der kurzen Frist ein probates Mittel, um Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern zu erlangen. Es scheint auch sehr viel risikoloser, ein gut bekanntes Geschäftsmodell zu optimieren, als ein neues zu definieren und zu implementieren, denn die Gefahr des Scheiterns ist in diesem Fall wesentlich höher. Zudem lassen sich durch die Optimierung kurzfristig die Probleme überdecken – bis zum großen Kollaps.
Allerdings ist die Wahrnehmung von Risiken oft trügerisch, wie das Beispiel der beiden Männer in der Wüste zeigt, die von einem Löwen bedroht werden. «Ich muss nicht schneller laufen als der Löwe», meint der eine zum anderen, «sondern nur schneller als du.» Zwar ist das nicht von der Hand zu weisen, doch gilt auch: In der Wüste gibt es noch andere Löwen – wie auch viele unbekannte zusätzliche Gefahren. Auf Unternehmen übertragen: Die betriebliche Effizienz zu erhöhen, um sich gegen bekannte Wettbewerber durchzusetzen, ist gut, aber keine Garantie dafür, dass man nicht durch disruptive, teilweise branchenfremde neue Konkurrenten sehr schnell obsolet wird.
Unternehmen tun deshalb gut daran, sowohl für das Arbeiten im System als auch für jenes am System eine Haltung einzunehmen, die Evolution und Anpassung sozusagen in der DNA hat. Sie tun auch gut daran, auf das geballte Wissen, Können und Wollen ihrer Mitarbeitenden zu setzen – denn Innovation kommt nicht nur von oben nach unten. Ganz im Gegenteil: In Zeiten erhöhter Veränderungsgeschwindigkeit sind Innovationen durch kundennahe Mitarbeitende Gold wert – und traditionelle, langsame Wege zur Innovation (über Forschung und Patente) verlieren an Bedeutung (siehe Kapitel 7 «Gamebreaking und Fakebreaking» auf Seite 71). Die Mitarbeitenden ihrerseits tun gut daran, sich auf diese ganz persönliche Herausforderung einzustellen und zu Gamebreakern zu werden, damit sie eine berufliche Zukunft haben.
Basierend auf dem Management 1. Ordnung, ausgerichtet auf die Strukturen und Prozesse des Unternehmens, ist ein Management 2. Ordnung vorzusehen, das im Allgemeinen sehr viel fundamentalere Veränderungen zur Folge hat. Quasi ein Metamanagement, welches das Geschäftsmodell und die ihm zugrundeliegenden Hypothesen permanent reflektiert und den sich verändernden Bedingungen anpasst, um die sich bietenden Möglichkeiten zum eigenen Vorteil zu nutzen. Dasselbe gilt – mutatis mutandis – auch für jeden Einzelnen von uns: sich darauf einzustellen, dass Prozesserfüllung allein nicht mehr genügt. Oder aber, falls Prozesserfüllung in einem Unternehmen genügt, sich bewusst sein, dass man ein zweifaches Risiko eingeht: abgebaut zu werden oder – noch schlimmer – mit dem in der Prozessmanie erstarrten Unternehmen unterzugehen. Gefragt ist deshalb eine Kultur des Gamebreaking von Managern und Mitarbeitenden.
 Aus dem Gruselkabinett der Anti-Gamebreaker: Forecast Calls, Reporting, Country Reviews
Aus dem Gruselkabinett der Anti-Gamebreaker: Forecast Calls, Reporting, Country Reviews
Wie kann ein Unternehmen zu einem Gamebreaker werden? Der erste Schritt dazu ist, lieb gewordenes Verhalten abzulegen, das eine echte Gamebreaker-Haltung verunmöglicht. Viele traditionelle Großunternehmen funktionieren nämlich nach einem ganz einfachen Führungsgrundsatz, den man als «Predict and control» bezeichnen könnte. Die Zentrale macht Vorgaben, die Geschäftseinheiten und Landesorganisation haben zu liefern und werden akribisch und permanent kontrolliert. Die entsprechenden Führungsinstrumente dafür sind Forecast Calls, ein aufwendiges, mindestens wöchentliches Reporting und Country oder Business Reviews.
Das Prinzip und die Führungsinstrumente scheinen auf den ersten Blick sinnvoll – bei näherem Betrachten verkörpern sie vieles von dem, was Großunternehmen daran hindert, langfristig erfolgreich zu sein. Aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung eines Autors dieses Buches lassen sich fünf Anti-Gamebreaking-Axiome ableiten:
Axiom 1 – Defokussierung: Je schlechter es einem Unternehmen geht, desto mehr setzt es auf «Predict and Control»-Mechanismen. Diese verschärften Kontrollmechanismen werden eingeführt mit der scheinbar einleuchtenden Begründung, verstehen zu wollen, was schiefläuft. Das hat aber verheerende Folgen, denn es bindet enorm viele Ressourcen, ohne dass ein Kunde einen Vorteil daraus hätte. Und es lenkt den Blick und die Energie der Geschäftseinheiten und Landesorganisationen, die das Geschäft eigentlich vorantreiben und ihren Kunden einen Mehrwert bringen sollen, auf rein interne Alibiübungen.
Axiom 2 – Verwirrung: Je mehr ein Unternehmen auf starre «Predict and control»-Mechanismen setzt, desto weniger wird es verstehen, was schiefläuft. Und dies aus einem einfachen Grund: «Predict and control»-Übungen werden typischerweise dann in Überdosis verordnet, wenn die Ziele verfehlt werden. Wenn ein ganzer Bereich, ein Land oder ein Vertriebsmitarbeitender die Vorgaben verfehlt, ist das schlimm – der Betreffende ist nicht «predictable». Aber noch sehr viel schlimmer – und allenfalls «career-ending» – ist es, wenn der Betroffene nicht erklären kann, warum zum Beispiel die Großbestellung von Kunde X ausgeblieben ist. Nun können die Gründe dafür mannigfaltig sein: das Ordering-System beim Kunden ist ausgefallen, wegen eines personellen Wechsels an der Spitze wurden alle Bestellungen gestoppt oder schlicht und ergreifend hat jemand vergessen zu bestellen. Es können buchstäblich Hunderte von Gründen sein, die der entsprechende Vertriebsmitarbeitende unmöglich kennen kann. Nur muss er vorgeben, den Grund genau zu kennen. Denn das ehrliche «weiß ich nicht» wäre tödlich. Um zu überleben, wird er die Wirklichkeit so konstruieren, dass erstens der Eindruck entsteht, er kenne den Grund ganz genau, und zweitens, es treffe ihn beim besten Willen keine Schuld für die nicht eingetroffene Bestellung. Es wird ein Bild einer «objektiven», monokausalen Wirklichkeit an der Kundenfront konstruiert und gleichzeitig wird vorgegaukelt, dass der Mitarbeitende den Kunden «im Griff» hat, und dies nur mit einem Ziel: noch ein Quartal Gnadenfrist zu erhalten.
Axiom 3 – Simplifizierung: Die Fiktion der «objektiven Wirklichkeit» und die Fiktion der «Beherrschbarkeit» und «alles im Griff zu haben» führen zu einer simplifizierten Sichtweise der Wirklichkeit – und wenig hilfreichen Handlungsanweisungen aus den Führungsetagen. Wenn ein Vertriebsmitarbeitender beispielsweise seine Margenziele verfehlt, wird ein Europa-Vorgesetzter, ohne dabei rot zu werden, den ganz einfachen Lösungsvorschlag machen: Verkauf ein bisschen mehr vom Produkt X, denn da sind die Margen besser. Natürlich hat der Vorgesetzte selbst einmal im Land und ganz nah an der «Kundenfront» gearbeitet – und er wusste damals ganz genau, dass die Sache nicht so einfach ist. Nur: Nun ist er auf Stufe Europa angesiedelt und übernimmt blitzschnell (manchmal innert Tagen) die ihm zur Pflicht gemachte Perspektive auf die Wirklichkeit: Wir haben es im Griff, und wenn doch etwas nicht gut ist, dann «executen» die da unten einfach nicht richtig. Das führt dann zu gegenseitiger Frustration: Der Vertriebsmitarbeitende fühlt sich veräppelt, der Europa-Boss nicht ernst genommen, wenn sein Ratschlag nicht unverzüglich umgesetzt wird.
Axiom 4 – Vernebelung: Je schlechter es einem Unternehmen geht, desto weniger dürfen die wahren Gründe dafür genannt werden. Je schlechter es einem Unternehmen geht, desto mehr fühlen sich insbesondere die höheren Kader gefährdet. Denn ein Account-Manager oder ein Service-Mitarbeitender an der «Kundenfront» erbringt eine messbare Leistung (Umsatz, Kundenzufriedenheit) und wird oft durch seinen Kunden geschützt. Das mittlere und obere Management ist nur durch sich selbst geschützt – aber wenn es hart auf hart kommt, dann hackt eine Krähe auch einer anderen ein Auge aus. Dies führt zu drolligen, allerdings für das Unternehmen auch tragischen Vernebelungstaktiken in den sogenannten Country oder Business Reviews. In einem solchen Review evaluiert das höhere Management-Team eine Landes- oder Geschäftseinheit. Country Reviews sind straff strukturierte Übungen, oft mit Formatvorlagen für die Powerpoint-Slides und engem Zeitplan, der verhindert, dass spontane Gespräche entstehen. Bevor es allerdings zu dieser meist mit vielen Slides und unendlich vielen Datenfriedhöfen in Excel-Sheets angereicherten Reviews kommt, werden bis zu sieben Probeläufe angeordnet, die von verschiedenen Vorgesetzten im mittleren Management geführt werden. In diesen Probeläufen geht es vor allem um eines: den Prüflingen politische Korrektheit einzubläuen, und zwar aus folgendem Grund. Wenn es nämlich schlecht läuft, sind die Ursachen für das Versagen oft nicht bei externen Faktoren oder den Mitarbeitenden an der «Kundenfront» zu suchen, sondern bei ebendiesen mittleren oder oberen Unternehmenskadern. Doch das auszusprechen könnte in der – wegen der schlechten Resultate – aufgeheizten Stimmung zu empfindlichen Reaktionen vor allem im besonders exponierten höheren Management führen. Deshalb erhält das lokale Management meistens zwei Vorgaben: Erstens kritisch nur solche Punkte anzusprechen, die man im Land selbst lösen kann (kein «Fingerpointing», und schon gar nicht nach oben!). Und zweitens die schlechte Performance auf die mangelhafte lokale «Execution» zu schieben.