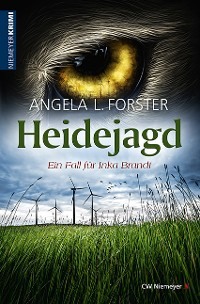Czytaj książkę: «Heidejagd»
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2021 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: C. Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com
EPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbH
eISBN 978-3-8271-8401-6
Angela L. Forster
Heidejagd

Schmerzliche Dinge, die uns in der
Vergangenheit widerfahren sind,
haben viel damit zu tun, wie wir heute sind.
William Glasser, Psychotherapeut
Prolog
Lea rannte und rannte, immer schneller und schneller. Die Angst vor dem Untier trieb sie voran. Wo waren die anderen? Wo war Konstantin, ihr Freund? Sie wollten sich doch am Waldbad treffen. Dieses blöde Paintballspiel.
Hinter ihr hörte sie das grässliche Knurren und Schnaufen der Bestie. Ein Werwolf, sie hatte ihn gesehen. Er war aus dem Gebüsch gesprungen und hatte sie angefallen. Ein Untier mit roten brennenden Augen und gefletschten Zähnen und … Lea konnte nicht mehr denken, nur laufen.
Sie sprang über Baumstümpfe, schlug sich durch das Gebüsch des Parks und weiter am Seeufer entlang. Brombeerbüsche und Dornenhecken zerkratzten ihr Gesicht, die Arme und Hände. Sie musste zum Parkplatz und dann weiter auf die Straße, nur dort war es möglich dem Monster zu entkommen. Doch so schnell sie auch lief, das blutgierige Tier hinter ihr kam immer näher. Dumpfe schwere Schritte, die auf dem Waldboden auftrafen, in ihren Ohren dröhnten, ihr Herz immer kräftiger schlagen ließen. Lea wollte schreien, doch ihr versagte die Stimme. Nur noch über die Brücke und dann … Sie lief und lief, dann stürzte sie kopfüber über ein Hindernis. Es war weich und warm. Ihre Hände berührten etwas Nasses und Klebriges. Als sie aufstand, sah sie, worauf sie gefallen war. Ihr Biologielehrer Hendrik Schubert lag mit zerfetztem Oberkörper in einer Blutlache auf der Holzbrücke des Lopausees.
Lea schrie. Ein Schrei, der durch den frühen Morgen hallte und jedes Geräusch am See überdeckte. Herbstliches Laub, das im Spiel des Windes raschelte, frühmorgendliche Gesänge der Gartenrotschwänze und Kohlmeisen. Kaninchen, Füchse, Mäuse, Igel, sogar der Biber, Tiere, die im Wald Nahrung suchten, umherhuschten, hielten inne. Nichts war zu hören. Nur Leas Atem, der stoßweise und abwechselnd mit dem Schrei aus ihrer Kehle schoss, als würde er aus seinen Fesseln befreit.
Kapitel 1
Inka Brandt blinzelte in die Dunkelheit. Sie drehte sich im Bett auf die rechte Seite und griff mit der Hand auf die andere Seite. Sie war leer. Drei Monate waren vergangen, seitdem Sebastian öfter bei ihr geschlafen hatte als in seinem Wilseder Untermieterzimmer. Seit dem letzten Fall des Heideimkers Ludwig Wittendorf waren sie ein Paar. Sehr zu Paulas Freude, Inkas fünfjähriger Tochter, die stolz verkündete, sie hätte jetzt zwei Papas. Vorgestern war Sebastian zu seinen Eltern nach Hamburg-Othmarschen gezogen. Zur Sicherheit für sie und Paula. Er wollte sie nicht in Gefahr bringen, den Kreuzer nicht weiter auf sie aufmerksam machen. Der Radiowecker zeigte mit roten Zahlen 1.44 Uhr an. Zu früh zum Aufstehen, befand sie, zog die Decke unter das Kinn und schloss wieder die Augen, dann vibrierte ihr Handy auf dem Nachttisch. Oh nein. Das bedeutet nichts Gutes. Verschlafen tastete sie nach dem Telefon. Sie drückte die Annahmetaste und wühlte sich aus der Decke.
„Brandt“, meldete sie sich gähnend. Bloß keine Leiche, ging ihr durch den Kopf. Am Wochenende wollte sie mit Paula in die Salztherme nach Lüneburg, ins verrückte Haus und in den Snow Dome nach Bispingen, dann kam Halloween. Für die Jagd auf Süßigkeiten wünschte sich Paula ein Feenkostüm. Außerdem hatte Inka ihr versprochen, einen Kürbis zu schnitzen und die gruselige, kichernde Hexe an die Tür zu hängen. Doch käme jetzt ein Mord … „Verdammt!“, fluchte sie leise. Wenn sie jetzt ihre Schwester Hanna aus dem Bett scheuchte, um auf Paula aufzupassen, war ihr die Standpauke ihres Schwagers sicher. Tim befand ihren Beruf als Kommissarin für überflüssig. Es wäre wirtschaftlicher, würde sie täglich, nicht nur sporadisch, auf dem Hof mitarbeiten. Mit Tims Predigt im Kopf horchte sie auf Frauke Bartels’ kräftige Stimme.
„Inka, bist du wach? Ich bin es, Frauke hier“, sagte die Beamtin aus der Zentrale. Frauke Bartels arbeitete seit drei Jahren in der Hanstedter Wache. Eine sechsundzwanzigjährige kunterbunt gekleidete Kollegin, die äußerlich eher in eine Kindergartengruppe als zur Polizei gepasst hätte.
„Unverkennbar“, nuschelte Inka in den Hörer. „Ich muss nicht fragen, was es gibt. Oder?“
„Ich dachte, unsere Inka würde gerne um zwei Uhr morgens einen Rundgang um den Lopausee in Amelinghausen machen.“
Inka hörte ein Kichern.
„Frauke, das ist nicht dein Ernst.“ Inka stöhnte und wischte sich mit der freien Hand ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. „Also, spuck’s aus. Was ist los?“ Sie rollte sich auf die Bettkante und schaltete die Salzkristalllampe ein.
„Ein Mädchen, anscheinend eine Schülerin, ist über ihren toten Biologielehrer auf der Seebrücke gestolpert, weil sie ein Werwolf verfolgt hat.“
„Ein toter Lehrer und ein Werwolf?“ Gedanklich ging Inka die Mondphase durch. Vollmond.
„Genau. Sie zählte noch ein paar Namen auf, die ich durch ihr Schluchzen kaum verstehen konnte, und sagte, dass sie am See ein Spiel gespielt hätten, als sie der Werwolf verfolgt hat. Rommel, Faller, Amselfeld und die Kollegen der Nachtschicht sind bereits unterwegs.“
„Okay. Wer ist das Opfer?“
„Sagte ich schon, ihr Biologielehrer. Ist Sebastian bei dir?“, fragte Frauke in einem Atemzug.
„Nein. Er ist in Hamburg bei seinen Eltern. Ich …“ Inka zögerte. Sebastian Schäfer, Polizeipsychologe aus Hamburg, war auf der Jagd nach dem Kreuzer, dem Mörder seiner Familie, drängender und verlangender als je zuvor.
„Ich dachte nur, dass du dir den Tatort ansehen möchtest“, holte Frauke sie aus ihren Gedanken.
„Der Tag fängt ja gut an“, stöhnte Inka. „Ruf Mark, die Spusi und Teresa an. Ich mach mich auf die Socken.“
Keine halbe Stunde nach dem Telefonat mit Frauke lenkte Inka ihren Golf auf den Parkplatz neben das Café-Restaurant Seestübchen am Lopausee in Amelinghausen. Der Streifenwagen von Faller und Rommel parkte mit zuckendem Blaulicht neben einem Berg achtlos hingeworfener Fahrräder. Schwarze Outdoorwesten, übersät mit gelben und signalroten Farbklecksen, wie Gewehre, die Inka als Paintballmarkierer erkannte, häuften sich neben den Rädern. Drei Streifenwagen kreisten die Jugendlichen ein und gaben ihnen keine Möglichkeit, zu verschwinden. Beaufsichtigt von Kollege Rommel standen sie dicht zusammengerückt neben zwei hölzernen Wagenrädern, die dem Parkplatz als Zierrat dienten.
„Sind die Eltern informiert, wo sich ihre Kinder rumtreiben?“, fragte Inka den Kollegen Faller, der sein Funkgespräch beendete.
„Ist gerade geschehen, Inka. Die haben sich gefreut, dass sie ihre Kinder abholen dürfen. Die Kids können sich auf ein Donnerwetter vom Feinsten gefasst machen.“ Er nickte mit dem Kinn zu den Schülern. „Diese Gören, was denen einfällt. Mitten in der Nacht ein Paintballspiel am See. Wofür gibt es denn Hallen für dieses verrückte Rumgeballere? Zwei wollten verduften, aber Meyer und Kruschke haben sie eingefangen. Die kriegen zu Hause ordentlich was auf die Mütze.“ Faller lachte, aber es wirkte nicht besonders amüsiert.
„Wo ist das Mädchen, das die Leiche gefunden hat?“, fragte Inka, ohne auf Fallers Worte einzugehen.
„Die Blonde, die der Jüngling im Arm hält. Lea Ohlsen heißt sie.“ Er wippte mit dem Kinn zu einer Schülerin, die ihren Kopf in die Halsbeuge eines dunkelhaarigen Jungen gelegt hatte.
In diesem Augenblick näherten sich dem Parkplatz vier weitere Fahrzeuge. Inka erkannte den neuen Wagen ihres Kollegen Mark Freese, den er gegen seinen biergelben Minicooper getauscht hatte. Als Familienvater eines drei Monate alten Sohnes hatte er mit seinem Siebensitzer für weiteren Kindersegen vorgesorgt.
Mark war seit Schulzeiten ein Freund, ein Kollege, den ein Zimthauch umgab, den er wie eine Schleppe hinter sich herzog. Sie wusste immer, in welchem Raum er sich aufgehalten hatte, obwohl er den längst verlassen hatte. Keksfabrik Freese & Söhne & Söhne, eine traditionsreiche Familie, in der er bei seinen Eltern sporadisch aushalf und mit kreativem Gespür neue Gebäcksorten entwickelte. Hinter Marks Wagen folgte Oberkommissar Jacob Amselfeld in einem Streifenwagen. Zwei weitere Wagen, schwarze SUVs, hielten mit knirschenden Reifen vor der Schranke, die den Parkplatz von dem beginnenden Naturschutzgebiet trennte. Ein Elternpaar stieg aus und eilte zu einem dunkelhaarigen Mädchen. Aus dem zweiten SUV schlüpfte eine zierliche Frau mittleren Alters. Noch bevor Inka den Parkplatz überquert hatte und bei den Jugendlichen angekommen war, ging auch schon das Donnerwetter los. Ein Elternpaar schimpfte wie wild auf seine Tochter ein, sodass Rommel Mühe hatte, die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen.
„Inka Brandt, Wache Hanstedt“, stellte sich Inka vor und hielt ihren Ausweis in die Runde der immer mehr eintrudelnden Eltern. „Ich möchte um Ruhe bitten. Hauptkommissar Mark Freese und ich“, Inka nickte zu Mark, „wir werden gleich zu Ihnen kommen. Wir bitten Sie, sich noch ein wenig zu gedulden.“
„Hören Sie, Frau Kommissarin, es ist mitten in der Nacht, ich habe in ein paar Stunden zu arbeiten, und ich muss …“
„Es ist früh am Morgen“, berichtigte Inka und sah einem kleinen dicken Mann mit schütterem Haar in graue Augen. „Sie werden warten, wie alle anderen auch, Herr …“
„Grünhagen. Steuerkanzlei Sigfried Grünhagen. Und dies ist mein Sohn Maximilian.“ Grünhagen nickte zu einem blonden Lockenkopf, der Inka um einen Kopf überragte und sie aus wasserblauen Augen linkisch angrinste. „Was er auch angestellt hat, es wird bis morgen Zeit haben“, drängelte Grünhagen. Er warf seinem Sohn einen strengen Blick zu, woraufhin dessen Grinsen sofort einfror.
„Herr Grünhagen, wir wurden alle an diesem frühen Morgen aus den Federn gescheucht. Und niemandem gefällt es, in der Kälte zu stehen. Sie können sich in Ihren Wagen setzen, doch sollte Ihnen einfallen wegzufahren, wird mir etwas einfallen, Sie aufzuhalten. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe eine Leiche zu begutachten.“ Sie warf einen kurzen Blick in die Runde der Elternpaare, drehte sich um und ging ein paar Schritte Richtung Schranke.
„Ist das Opfer tatsächlich der Biolehrer der Schüler?“, fragte sie Faller, der abseits der Elterngruppe auf seinem Handydisplay tippte.
„Ja. Hendrik Schubert. Biologielehrer aus dem Amelinghausener Pastor-Bode-Eliteprivatgymnasium“, sagte er und steckte das Handy in die Jackentasche. „Unterrichtet hat der Biolehrer alles reiche Schnöselkinder, die mit dem goldenen Löffel im A…“ Er zögerte. „Na ja, die haben nix anderes zu tun, als Blödsinn anzustellen und die Nase in den Wind zu halten, während ihre Eltern mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Arzt, Rechtsanwalt, Autohaus, Steuerkanzlei, Schauspieler, Unternehmer und so weiter. Die Kindererziehung, geschweige Aufmerksamkeit für den Spross, bleibt auf der Strecke. Was zählt, sind das Bankkonto und die Karriere. Alles Menschliche wird dem Kindergarten, der Schule oder irgendjemandem überlassen und vergessen oder verdrängt, dass es ihre Kinder sind, die ihnen entgleiten. So läuft das heute. Natürlich nicht bei allen Eltern, so weit lehne ich mich nicht aus dem Fenster.“ Kollege Faller hatte sich in Rage geredet, wie immer, wenn es um das Thema Kinder ging.
Inka schenkte den Worten ihres Kollegen ein Nicken. Auch Tilly, Paulas Tagesmutter, berichtete über Kinder, die als Anhängsel oder Standessymbol am Rande der Familie mitliefen, in der die eigene Bequemlichkeit oder Karriere einen präsenteren Platz einnahm.
„Gibt es eine Überwachungskamera an der Außenfassade des Café-Restaurants?“ Inkas Blick schweifte zum Seestübchen, das im Bungalowstil mit dem weißen Anstrich und dem grauen Ziegeldach verlassen dalag. Der Laubteppich, der sich vor dem Eingang ausgebreitet hatte, verriet, dass hier in letzter Zeit kaum Betrieb geherrscht hatte. Es war Winterpause.
„Das weiß ich nicht.“ Faller zuckte die Schultern. „Ich sehe nichts.“
„Kümmere dich darum. Wo geht’s zur Brücke?“
„Hinter der Schranke geradeaus, nach ungefähr zweihundert Metern müsst ihr links auf die Brücke. Teresa und Kollege Amselfeld erwarten euch.“
„Danke“, sagte sie zu dem Mittdreißiger. „Achte darauf, dass mir keiner von der Bande stiften geht. Und sperre hier alles ab“, warf sie ihm über die Schulter zu.
Mittig auf der Holzbrücke, die über die Lopau führte, lag ein Mann. Zerrissen und blutdurchtränkt hing seine Kleidung an seinem Oberkörper herunter. Eine Hand steckte in der Hosentasche seiner Bluejeans, die andere lag über dem Steg. Mit offenen Augen starrte er in den sternenfunkelnden Himmel.
„Du meine Güte, das sieht ja wie eine Hinrichtung aus“, sagte Inka. Sie nickte Amselfeld zu und begrüßte ihre Freundin, Rechtsmedizinerin Teresa Hansen, mit einem Kuss auf die Wange.
„Das kann man wohl sagen. Es geht immer noch grausamer. Guten Morgen, Süße, Mark“, erwiderte die sportliche Mittvierzigerin.
„Was denkst du, Terry? Was war das für ein Messer, das ihn so zugerichtet hat?“, fragte Mark. Sein Blick lag auf den Holzbohlen und dem Blut, das sich fast schwarz wie eine Öllache verteilte.
Teresa schüttelte den Kopf. „Mit einem Messer zu töten, ist eine sehr persönliche Sache. Es steckt viel Wut dahinter. Doch sehe ich mir die Schnittwunden in Gesicht-, Brust- und Bauchbereich an, … haltet mich bloß nicht für verrückt …“, Teresa zögerte und warf Inka, Mark und Amselfeld einen irritierten Blick zu, „… haben scharfe Krallen die Wunden verursacht. Ich würde sagen, er hat mit einer Bestie, einem Werwolf, gekämpft.“
Ein banges Gefühl machte sich in Inka breit. Sie fühlte sich nie gut, wenn sie mit solchen Absurditäten konfrontiert wurde. Viele mystische Geschichten geisterten durch die Lüneburger Heide. Doch das war für sie nur hanebüchener Unsinn. Weder glaubte sie an Geister noch an irgendwelche Spukgeschichten, dafür war sie zu sehr Realistin. Dennoch spürte sie, wie sich eine Gänsehaut über ihre Arme legte.
„Das ist doch Blödsinn, Terry. Es gibt keine Werwölfe in der Heide … Wer glaubt solch einen Mist?“, sagte Inka.
„Ich bin ganz deiner Meinung. Aber sieh dir dies an.“ Teresa leuchtete mit der Taschenlampe über den Kopf des Toten.
„Das ist ein Fußabdruck“, sagte Inka.
„Und zwar ein gewaltig großer Fußabdruck, der nicht von einem Schuh stammt“, stimmte Mark zu. „Der sieht tatsächlich aus wie von einem riesigen Tier. Oder, Kollege Amselfeld, was sagen Sie?“ Mark drehte den Kopf zu seinem Kollegen, der zwei Meter abseits mit dem Rücken am hölzernen Brückengeländer lehnte.
Jacob Amselfeld nickte. Er war müde und gähnte. „Sicher war es ein Tierwesen, ein Mensch in einem Pelzkostüm“, sagte er.
„Sie sprechen von einer Fetischgeschichte, Kollege.“ Aus der Hocke sah Inka zu Amselfeld hoch.
„Wäre möglich. Allerdings müssen wir zwischen Petplayern und Pelzliebhabern unterscheiden.“
„Können Sie sich genauer ausdrücken?“, drängelte Inka, während sie aus der Hocke aufstand.
„Es gibt die Petplayer, bei denen einer den dominanteren Part, der andere den devoteren Part spielt. Ein Partner verkleidet sich als Pferd, Zebra, Hund oder beliebiges Tier, das vom anderen Partner dressiert und dominiert wird. Es ist eine Erotik, die nur im Kopf stattfindet. Wobei die Petplayer diese sogar öffentlich zur Schau stellen, indem sie durch Parks oder auf Straßen herumlaufen oder -fahren. Die anderen sind die Pelzliebhaber. Menschen, die ihr zweites Ich ausleben. Anhänger gibt es auf der ganzen Welt. Sie verkleiden sich zum Spaß als Tierwesen, veranstalten Partys, Tanzveranstaltungen oder Picknicks in ihren Pelzen, die sie Suits nennen, also Anzüge. Aber von einem Mord hab ich noch bei keinem etwas gehört.“
Marks, Teresas und Inkas Augen richteten sich neugierig und ebenso belustigt auf den Kollegen. „Wow“, sagte Inka, die als Erste wieder Worte fand. „Sie kennen sich in der Szene gut aus.“
„Das liegt an meiner Frau …, weil …“, begann Amselfeld und stockte, als er sah, dass Teresa, Inka und Mark ihn grinsend ansahen.
„Sparen Sie sich Ihr Hohngelächter. Ich weiß, was Sie denken“, sagte er, das Gesicht zu einer strengen Miene verzerrt. „Meine Frau promoviert über das ungeschürte Verlangen in Sex-, Arbeits- und Organisationspsychologie. Das Thema ist Teil ihrer Arbeit“, setzte er erklärend nach.
„Ähm, ja“, sagte Teresa, „wie spannend, bald eine weitere Doktorin in unserer Runde zu finden, aber wenn wir uns trotzdem wieder unserem Fall zuwenden könnten, denn wir haben nicht nur den Fußabdruck, sondern auch eine Zeichnung.“ Mit dem behandschuhten Zeigefinger tippte Teresa neben den Fußabdruck auf ein gemaltes Zeichen.
„Das sieht wie ein umgedrehtes Z mit einem Strich in der Mitte aus“, sagte Amselfeld.
„Es ist das Zeichen der Wolfsangel“, erklärte Inka. „Das Zeichen der Forst- und Waldwirtschaft, das der Heidedichter Hermann Löns gerne unter seine Unterschrift gesetzt hat.“
„Es sprach unsere Geschichtslehrerin, Inka Brandt.“ Teresa lachte. „Aber du hast recht. Als Flora und ich den Resthof in Egestorf gekauft haben, lag an unserer Einfahrt auch ein Hofstein mit dem Zeichen der Wolfsangel. Wir haben ihn entfernt, da die Angel nicht nur ein Zeichen für die Forstwirtschaft war, sondern auch für die Hitlerjugend.“
„Davon hab ich nie gehört. Zeichen, Hitlerjugend, Wolfsangel. Wie hängt das zusammen?“, fragte Jacob Amselfeld, der in die Heide zugezogene Kölner Kollege.
„Es ist nicht nur ein Zeichen, sondern auch ein eiserner Doppelhaken, ein Köderträger und Fanggerät für Wölfe“, ergänzte Inka. „Im 16. Jahrhundert wurde er von den Bauern mit Ködern versehen und mittels eines Ankers in Bäume gehängt oder darin befestigt. Die Wölfe, die hochsprangen und sich die Beute schnappten, blieben mit der Schnauze an den Widerhaken hängen und verendeten.“
„Aber was hat diese Grausamkeit mit der Hitlerjugend zu tun? Die Wolfsangel hab ich …“, begann Amselfeld, als ihn Inka unterbrach.
„Verschlafen?“ Inka grinste, wurde aber sofort wieder ernst und sagte: „Richtig populär machte die Wolfsangel der Heidedichter Hermann Löns durch sein Buch Der Werwolf. Darin geht es um eine Heidebauerngemeinschaft, die sich Werwölfe nannte. Den mystischen Bezug gaben die Nazis der Wolfsangel, indem sie das Symbol, das noch heute auf vielen Städte- und Gemeindewappen zu finden ist, zu einer germanischen Rune erklärten. Die Nazis verehrten Hermann Löns, der im Ersten Weltkrieg gefallen war. Auf Befehl Hitlers betteten sie seine mutmaßlichen Gebeine um in ein Grab in die Lüneburger Heide nach Bad Fallingbostel, das heute zu einer Art Pilgerstätte geworden ist. Wie Sie sehen, Kollege Amselfeld, ist das Feld der Angel vielfältig und weitreichend, wobei wir uns offensiv mit der Geschichte des Nationalsozialismus und auch mit den heutigen rechtsextremistischen Strömungen auseinandersetzen müssen. Es wird immer Menschen geben, die Meinungen vertreten, die wir nicht unter einem kritisch aufgeklärten Geschichtsbild verstehen.“
„Ich stimme dir in allen Punkten zu, Inka. Aber wir agieren als Polizisten mit einer Vorbildfunktion“, bemerkte Mark, dann: „Kennt ihr Hitlers Spitznamen?“
Kopfschütteln.
„Onkel Wolf wurde er genannt. Ich erwähne es nur, weil es außerdem die Organisation Werwolf gab, die Jagd auf kriegsmüde Deutsche machte. Angeführt gegen Kriegsende von dem ehemaligen Hühnerzüchter Heinrich Himmler“, ergänzte Mark.
„Bei ,Hühnerzüchter‘ klingelt es.“ Amselfeld wurde zusehends munterer. „Ich glaub, davon hab ich doch schon gehört. Haben nicht sogar Papst Benedikt XVI. und der Literaturnobelpreisträger Günter Grass in Uniform als Jugendliche stolz für die Fahne gekämpft?“
„Stimmt, das war auch bei uns Thema im Geschichtsunterricht“, bemerkte Mark.
„Meint ihr, wir kriegen es jetzt mit den Braunen zu tun, während ein Werwolf bei Vollmond durch die Lüneburger Heide streift und sich seine Opfer sucht? Sollten wir Silberkugeln in unsere Waffen laden, bevor wir gebissen werden und selbst zum Werwolf mutieren?“, fragte Amselfeld. Er legte den Kopf in den Nacken und sah in den Himmel. Die Luft war klar und belebend. Der Mond präsentierte sich in milchig leuchtender Form und es schien, als sähe er amüsiert auf die vier Menschen herab, die auf der Brücke standen.
„Das sind alberne Aussagen und nur konstruierte Fiktionen der Filmindustrie, Kollege“, bemerkte Mark. „Die Wölfe sind in die Lüneburger Heide zurückgekehrt, aber ein Werwolf war sicher nicht unter ihnen. In drei Tagen ist Halloween, vielleicht hat sich jemand einen Scherz erlaubt.“
„Sehe ich genauso“, antwortete Inka. „Terry, kannst du uns etwas über den Todeszeitpunkt sagen?“
„Euer Opfer ist vier bis fünf Stunden tot.“
„Dann ist er gegen zweiundzwanzig Uhr ermordet worden.“
„Eine Stunde, ein paar Minuten früher oder später, du kennst das ja. Die Leichenstarre ist noch nicht vollständig ausgeprägt und ich kann sehen, was er in der rechten Hand hält, die er in der Hosentasche vergraben hat.“
„Einen Ring“, staunte Inka.
„Nicht nur einen Ring. Einen Diamantring. Er wollte einen Heiratsantrag machen.“ Sie ließ den Ring mit einer behandschuhten Hand in ein Beweistütchen rutschen.
„Bestimmt nicht einer Werwölfin“, scherzte Amselfeld. „So ein Gemetzel richtet keine Frau an, die einen Antrag bekommt.“
„Da haben Sie recht“, erwiderte Inka nachdenklich und nahm das Tütchen mit dem Ring entgegen. „Nur was hatte unser Opfer, bleiben wir beim Todeszeitpunkt zweiundzwanzig Uhr, am See auf der Holzbrücke zu suchen?“
„Ein Rendezvous mit seiner Herzallerliebsten“, sagte Amselfeld.
„So spät am Abend und in der Kälte am See? Es gibt romantischere Orte für Verliebte“, setzte Inka dagegen.
„Wenn ihr mit euren Taschenlampen zum anderen Ende der Brücke leuchtet“, mischte sich Teresa ins Gespräch, „könnt ihr sehen, dass der Fundort nur bedingt der Tatort ist, weil die Blutspuren auf den Waldweg zurückführen. Sein Rendezvous, wenn es eines war, hat woanders stattgefunden.“
„Dann ist er geflüchtet und auf der Brücke ermordet worden“, sagte Inka.
„Davon gehe ich erst einmal aus.“
„Doch woher kam er?“
„Gute Frage.“ Teresa Hansen zuckte die Schultern.
„Hast du ein Handy oder Papiere gefunden?“, fragte Inka.
„Fast alles hier. Seine Uhr, sein Fair-Trade-Ökophone und in …“
„Sein was?“, fragte Mark.
„Sein Handy. Es ist ein Ökophone mit austauschbaren Modulen, die einzeln ersetzt werden können. Ihr kennt das doch – ein Elektrogerät oder ein Smartphone ist nach einer gewissen Zeit defekt und du kannst es nur noch wegschmeißen. Angeblich wird es vom Hersteller so voreingestellt. Dieses Ding hier“, sie hielt das Handy hoch, „kannst du mit einem Schraubenzieher selbst reparieren, so hält es länger und die Teile sind natürlich fairtrade hergestellt.“
„Was es alles gibt“, sagte Mark kopfschüttelnd.
„Die Handys sind nicht billig, aber weiter … In seinem Portemonnaie sind einhundertzwanzig Euro, nur leider kein Personalausweis. Einen Raubmord könnt ihr ausschließen, weil der Täter auch die zwanzigtausend Euro mitgenommen hätte, die in der Innentasche seiner Jacke gesteckt haben.“
„Zwanzigtausend. Nicht schlecht“, staunte Mark.
„Genau. Außerdem hat er ein frisches Veilchen. Allerdings ist der Bluterguss noch nicht vollständig ausgebildet, was heißt, der Treffer hat ihn zeitnah, zwei oder drei Stunden vor seinem Tod, erreicht.“ Teresa tippte mit ihrem rechten behandschuhten Zeigefinger auf Hendrik Schuberts rechtes Auge. „Und die Gleichmäßigkeit der Verfärbungen sagt mir, sein Gegner hat direkt vor ihm gestanden, als ihn die Faust getroffen hat.“
„Wenn der Angreifer direkt vor ihm gestanden und das rechte Auge getroffen hat, dann ist er Linkshänder“, überlegte Inka laut.
„Davon könnt ihr ausgehen. Zumindest, was die Prügelei angeht. Aber ob der Prügelknabe auch der Mörder war?“
„Kriegen wir heute noch Ergebnisse, Terry?“
„Ich geb mein Bestes“, sagte die Rechtsmedizinerin. „Allerdings liegen bei mir im Institut zwei Alkoholleichen auf dem Tisch und eine Dreißigjährige, bei der der Todesumstand von Suizid bis Mord schwankt.“ Teresa stand aus der Hocke auf und schloss ihre Arzttasche. „Ich vermisse Sebastian. Schläft er noch?“ Suchend sah sie über Inkas Schulter.
„Sebastian ist in Hamburg bei seinen Eltern“, sagte Inka kurz. Dass Sebastian seit zwei Tagen bei seinen Eltern lebte, weil er glaubte, den Kreuzer so von ihr fernzuhalten, gefiel ihr nicht. Sie vermisste ihn. Aber es war seine Entscheidung und die fand sie allemal besser als den gefährlichen Plan, den er mit Flora, Teresas Lebensgefährtin, umsetzen wollte. Auch wenn die Idee der beiden, den Kreuzer aus seinem Versteck zu locken, noch nicht ausgereift war.
Teresa Hansen umarmte erst Inka, dann Mark, nickte Amselfeld zum Gruß zu und winkte Finn Reuscher, dem Polizeifotografen, und Fridolins Team der Spurensicherung, die mit schnellen Schritten die Brücke erreicht hatten. „Lasst mir das Opfer ins Institut bringen“, rief sie ihren Kollegen zu, bevor sie hinter den Bäumen in der Dunkelheit des frühen Morgens verschwand.
„Also gut“, sagte Inka, als Fridolins Team in weißen Schutzanzügen an ihr vorbeiwirbelte, Schildchen aufstellte, mit Lampen den Tatort belichtete, Pinzetten und Pinsel aus ihren Köfferchen holte und mit der Arbeit begann. „Folgen wir der Blutspur.“ Mit der Taschenlampe leuchtete Inka über die Holzbohlen und weiter auf den sandigen Waldweg, der Richtung Parkplatz führte.
„Wie merkwürdig“, hörte sie Mark sagen. „Warum flüchtete er nicht gleich in sein Auto?“
„Auf dem Parkplatz stand außer dem Smart mit Werbeaufdruck des Café-Restaurant Seestübchen kein anderes Auto“, erwiderte Inka.
„Vielleicht hat er seinen Wagen oben an der B209 abgestellt“, bemerkte Amselfeld.
„Unwahrscheinlich“, sagte Inka kopfschüttelnd. „Die Holzbrücke liegt vom Parkplatz aus auf der rechten Seite des Sees. Er müsste einen riesigen Bogen gegangen sein, um hier anzukommen. Wer macht so etwas, wenn es einfacher ist, den Wagen auf dem Parkplatz vor Ort abzustellen?“
„Stimmt“, pflichtete Mark bei. „Aber möglich ist, er wurde mitgenommen und am See abgesetzt. Oder er ist mit dem Taxi gekommen.“
„Und wie kommt er zurück?“
„Zurück wohin?“, fragte Amselfeld und sah Mark mit schläfrigen Augen an. „Wir wissen nicht, wo er wohnt, und wir wissen ebenfalls nicht, ob er verabredet war oder nur spazieren gehen wollte.“
„Mit zwanzigtausend Euro und einem Diamantring in der Tasche zu einem Abendspaziergang aufbrechen ist seltsam. Kriegen Sie raus, Amselfeld, wie das Opfer zum See gekommen ist? Mit dem Taxi, einem Freund, der Freundin oder wie auch immer? Fragen Sie in den umliegenden Taxizentralen nach, wer eine Fahrt zum See mit einem Fahrgast oder mehreren Gästen um die Tatzeit herum getätigt hat. Möglicherweise hat unser Opfer das Geld von seinem Mörder bekommen. Erpressergeld, Schutzgeld oder Schweigegeld, irgendetwas wird es gewesen sein. Wir brauchen die Fingerabdrücke auf dem Geld, Hendriks Kontobewegungen und die Bewegungsanzeigen sowie Anrufprotokolle auf seinem Handy“, ordnete Inka an. Sie leuchtete zurück auf die Blutspuren, die sie weiter Richtung Parkplatz führten. Mit der Taschenlampe schwenkte sie in den Busch- und Laubstreifen, der See- von Waldweg trennte. „Hier hört die Blutspur auf und macht einen Bogen. Amselfeld, Sie gehen den Seeweg entlang Richtung Aussichtsplattform. Mark, wir gehen zum Parkplatz und zum Café zurück, um nicht alle Spuren zu zertrampeln.“
Je näher sie dem Seestübchen kamen, desto lauter wurde das Stimmengewirr, das ihnen entgegenschlug. Inzwischen waren fast alle Eltern der Jugendlichen eingetroffen.
„Ich würde gerne mit Ihrer Tochter alleine sprechen“, bat Inka die Eltern der Schülerin Lea Ohlsen.
„Und was ist mit uns, wann können wir gehen?“, wollte Sigfried Grünhagen wissen.
„Mein Kollege nimmt Ihre Personalien auf.“ Sie nickte zu Mark.
„Wollen wir?“, fragte sie Lea und bat sie um ein paar Schritte. „Lea, bitte verraten Sie mir … oder darf ich Du sagen?“ Inka blieb an der Schranke stehen.
Das Mädchen nickte. Es war blass und Inka sah, dass seine Hände leicht zitterten.
„Lea, ich weiß, was du gesehen hast, war grausam. Wir reden nur so lange, wie du meinst, es verkraften zu können. Aber ich brauche ein paar Antworten. Was ist am See geschehen? Wann seid ihr am See angekommen? Wer kam auf die Idee mit dem Paintballspiel? Was hat es mit dem Untier, dem Werwolf, auf sich?“
„Es war eine dumme Idee“, flüsterte Lea. „Eigentlich wollten Konstantin und ich nur einen Abend, also eine Nacht, alleine verbringen. Seine Eltern waren zu Bekannten nach Soltau zu einer Hochzeit gefahren und wollten erst am nächsten Tag wiederkommen. Meine Eltern dachten, dass ich bei Kristina schlafe, aber …“ Lea zögerte, senkte den Kopf und sah auf den Sandboden.
„Ist Konstantin dein Freund? Er sieht nett aus.“ Inka fand, Lea verhielt sich ganz anders als die dickköpfigen Jugendlichen, mit denen sie sonst ab und an zu tun hatte.
„Ja, ist er auch. Und lange nicht so eingebildet wie Jannik, Peer oder alle anderen Jungs. Obwohl seinen Eltern das große Autohaus in Amelinghausen gehört.“
Inka warf einen schnellen Blick zu Konstantin und seinen Eltern. Als letztes Elternpaar kamen sie mit einem Golf zum See, nicht mit einem SUV. Mit Leas Eltern standen sie als restlich verbliebene Gruppe neben dem hölzernen Wagenrad und gaben Kollege Rommel Auskunft.