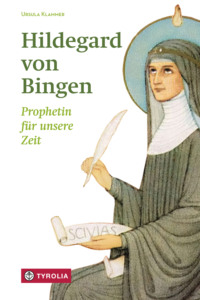Czytaj książkę: «Hildegard von Bingen», strona 3
Hildegard als Äbtissin
Bald nach der offiziellen Bestätigung Hildegards als Prophetin und Visionärin durch den Papst steigt auch der Bekanntheitsgrad der Benediktinerabtei auf dem Disibodenberg. Hildegards Ansehen als Vorsteherin der kleinen Frauenklause führt dazu, dass immer mehr Mädchen aus Adelsfamilien um Aufnahme in die klösterliche Gemeinschaft bitten. Die den Frauen zur Verfügung stehenden Klosterzellen reichen jedoch nicht aus, um alle Anwerberinnen aufnehmen zu können. Magistra Hildegard strebt insgeheim wahrscheinlich auch nach Unabhängigkeit vom Männerkloster und so denkt sie an die Gründung eines eigenen Konvents. Sie lässt ihre Umgebung wissen, dass Gott ihr diesen Plan bzw. Auftrag ins Herz gelegt hat. Der Ort für das neue Bauwerk wird Hildegard in einer Vision gezeigt. Auf dem so genannten Rupertsberg, wo die Nahe in den Rhein mündet und wo einst der heilige Rupertus gelebt hat, soll das neue Frauenkloster entstehen.

Die Ruinen des Klosters Disibodenberg heute. In diesem Trakt befand sich das Refektorium. Hildegard war mit Jutta von Sponheim eine der ersten Frauen, die in die ab 1108 errichtete Frauenklause des Benediktinerklosters einzog.
Ihre Mitbrüder, die Benediktinermönche vom Disibodenberg, legen sich allerdings quer: Sie wollen die Nonnen aus verschiedenen Gründen (vor allem wirtschaftlichen) nicht wegziehen lassen. Durch die zunehmende Bekanntheit Hildegards hat das Kloster in Form von großzügigen Schenkungen seitens des Adels profitiert. Diese Zuwendungen würden durch das Wegziehen der Nonnen mit Sicherheit geringer ausfallen. Bevor die Mönche endlich ihre Zustimmung zum Umzug geben, durchlebt Hildegard – mit kräfteraubenden Animositäten der Glaubensbrüder konfrontiert – eine lange und schwere Krankheitsphase. Als der Abt schließlich nachgibt, gesundet Hildegard allmählich wieder, sodass sie sich in den folgenden Jahren als Bauleiterin mit Energie und Entschlossenheit ihren ehrgeizigen Plänen widmen kann.
Das für die Klostergründung vorherbestimmte Gelände erwirbt die engagierte Ordensvorsteherin im Jahre 1147. Großzügige Schenkungen aus adeligen Kreisen sowie die Erbschaft von Gut Bermersheim, welches Hildegards Geschwister dem Kloster Rupertsberg übereignen, machen diesen ersten Schritt zur Unabhängigkeit der Frauengemeinschaft möglich.
Ein neuerlicher Konflikt mit Abt Kuno bahnt sich an, als dieser sich weigert, den Nonnen ihre rechtmäßigen Besitzungen auszuhändigen, die er bislang verwaltet hat – beispielsweise die Mitgift der Nonnen in Form von Liegenschaften und deren Erträge. Dadurch ist die weitere Finanzierung des bereits begonnenen Bauprojekts in Frage gestellt. Erst durch weitere Schenkungen seitens Hildegards Verwandtschaft und des lokalen Adels kann sich die in wirtschaftlicher Hinsicht kritische Situation entspannen.
Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse kann Hildegard im Jahre 1150 mit etwa 20 Nonnen das Klosterareal auf dem Rupertsberg beziehen. Anfangs ist die Geduld der Schwestern aufgrund noch nicht vorhandener bzw. nicht fertiggestellter Räumlichkeiten sehr gefordert. Ställe, Scheunen, eine Waschküche sowie ein Backhaus sind für eine mittelalterliche Klosteranlage ebenso unentbehrlich wie eine Kapelle und eine Klosterkirche. Auch an ein Skriptorium sowie an Kunstwerkstätten wird bei einer Klostergründung normalerweise gedacht. Hildegard waren diese ausgewiesenen Räume der Kunst- und Wissensweitergabe sicher ein zentrales Anliegen bei der Planung ihres Konvents. Zur Selbstversorgung müssen Felder und Äcker bestellt werden. Die nach und nach angelegten Gärten liefern Obst und Gemüse und in den umsichtig angelegten Kräuterbeeten werden Heilmittel für die eigene Klosterapotheke gewonnen.
Einige der adeligen Nonnen lehnen sich bald nach dem Wegzug vom Disibodenberg gegen die aus ihrer Sicht unannehmbaren Zustände und Entbehrungen in der neuen Unterkunft auf, andere verlassen – enttäuscht und überfordert – für immer das neu errichtete Kloster auf dem Rupertsberg.
Doch nach Bewältigung der anfänglichen Herausforderungen kann das Ordensleben auf dem Rupertsberg unter der klugen und fürsorglichen Leitung Hildegards aufblühen. Es dauert nicht lange, bis sich erneut junge adelige Frauen bei Hildegard vorstellen und um Aufnahme in die klösterliche Gemeinschaft bitten.
Die erste urkundliche Bezeugung des Klosters Rupertsberg fällt in das Jahr 1158. Von Kaiser Barbarossa lässt sich die vorausplanende Äbtissin 1163 einen Schutzbrief ausstellen, in dem die Besitzungen und Rechte der Ordensgemeinschaft ein für alle Mal bestätigt und abgesichert werden.

Kloster Rupertsberg um 1620, Stich in Meissner, Politisches Schatzkästlein, 1638.
Das von Hildegard von Bingen gegründete Kloster wird 1632 im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstört. Die Nonnen fliehen zunächst nach Köln, 1636 finden sie Zuflucht im Kloster Eibingen.
Die Klosteranlage auf dem Rupertsberg bietet für insgesamt 50 Nonnen Platz und Beschäftigung. Damit ist sie größer als die meisten Frauenklöster der damaligen Zeit, die durchschnittlich zwischen 20 und 30 Nonnen aufnehmen können. Innerhalb des Klosterbezirks gibt es auch eigene Häuser für Angestellte und Gäste. Wie ein späterer Sekretär Hildegards – Wibert von Gembloux – voller Bewunderung berichtet, hat die Bauherrin in allen Arbeitsräumen (vermutlich in der Küche, der Klosterapotheke, der Krankenabteilung, der Waschküche sowie in den Ställen) Rohre für Fließwasser anfertigen lassen. Ein Novum für die damalige Zeit!
Gute zehn Jahre später erweist sich die neu errichtete Klosteranlage aufgrund der weiterhin anwachsenden Frauengemeinschaft als zu klein. Hildegard entschließt sich, in Eibingen bei Rüdesheim ein verwaistes Augustiner-Doppelkloster zu erwerben. Die zielstrebige Bauherrin vom Rupertsberg lässt dieses durch Kriegswirren beschädigte Gebäude wieder herrichten, sodass bald darauf – im Jahre 1165 – insgesamt 30 Schwestern in das fertiggestellte Klostergebäude einziehen können. Im Gegensatz zu Hildegards Erstgründung, wo nur adelige Frauen Einlass fanden, werden in Kloster Eibingen vermutlich auch Mädchen bürgerlicher Herkunft aufgenommen.
Zweimal wöchentlich besucht die inzwischen hochbetagte Äbtissin die ihr anvertrauten Nonnen am gegenüberliegenden Ufer des Rheins. Dabei nimmt sie beachtliche Strapazen auf sich: Sie muss jedes Mal (vermutlich auf einem Kahn) den Rhein überqueren und einen relativ langen Fußmarsch bis zum Tochterkloster in Kauf nehmen.
Hildegards Predigtreisen
Trotz zunehmender Altersbeschwerden und strapaziöser Reisebedingungen (auf dem Rücken von Pferden, in der Kutsche, auf dem Schiff oder zu Fuß) unternimmt Hildegard zwischen 1158 und 1171 nachweislich mehrere Predigtreisen (vermutlich vier größere) quer durch Deutschland. Bei diesen Gelegenheiten besucht die gerngesehene Äbtissin auch einige befreundete Klöster. Auf öffentlichen Plätzen und in etlichen Kathedralen (u. a. in Köln, Trier, Lüttich, Mainz, Metz, Bamberg und Würzburg) wendet sie sich an das Volk und im Besonderen an die in Verruf geratene hohe Geistlichkeit. In der ihr zugewiesenen Rolle als „Posaune Gottes“ warnt Hildegard die Menschen eindringlich vor zunehmender Gottvergessenheit und dem Verlust moralischer Integrität.
Die Menschen – vor allem auch der Klerus – sollten ihr skrupelloses Verhalten ändern und sich um eine angemessene christliche Lebensweise bemühen. Die abstoßende Lebensführung vieler Geistlicher kommt auch in vielen Briefen der Seherin offen zur Sprache. Anstatt sich um ihre eigentliche Aufgabe – die Seelsorge und den Dienst an Armen – zu kümmern, bezichtigt Hildegard die geweihten Männer, wie besessen Reichtum und Besitz nachzulaufen und ein zügelloses Leben zu führen. Da Hildegard ganz offensichtlich im Namen einer höheren Autorität spricht und dementsprechend glaubwürdig den Willen Gottes kundtut, wird sie vom Volk respektiert und geachtet.
Nach längerer Krankheit stirbt die Prophetin und „Posaune Gottes“ am 17. September 1179. In ihrer Vita, herausgegeben von den Mönchen Gottfried und Theoderich, wird berichtet, dass zum Zeitpunkt ihres Todes ein großes Lichtkreuz am Himmel erschien.4 Das Datum ihres Sterbetags hatte sie ihren Schwestern vorausgesagt.
Hildegard – (k)eine Heilige?
Nach ihrem Tod gab es mehrere Versuche, die Seherin vom Rupertsberg offiziell heiligzusprechen. Warum diese letztendlich scheiterten, kann man heute nicht mehr genau nachvollziehen. Angeblich waren die Unterlagen nicht ganz vollständig, sodass diese mehrmals vom Papst mit der Bitte um Ergänzung an die Kirche von Mainz zurückgeschickt wurden. Diese zeigte sich im Gegensatz zur Rupertsberger Schwesterngemeinschaft an einer Kanonisierung Hildegards offenbar nicht sonderlich interessiert. Dessen ungeachtet wird Hildegard vom Volk schon bald nach ihrem Tod als Heilige verehrt, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ihre prophetische Botschaft zeichnet sich durch eine besondere Zuverlässigkeit und weitestgehend durch zeitlose Gültigkeit aus.
Obwohl Hildegard seit dem 15. Jahrhundert im Römischen Martyrologium als Heilige angeführt wird, sollte es noch einige Jahrhunderte dauern, bis Hildegard offiziell heiliggesprochen wird. Am 10. Mai 2012 wird die Kanonisation schließlich durch den deutschen Papst Benedikt XVI. feierlich vollzogen bzw. „nachgeholt“: Hildegard von Bingen, prophetissa teutonica – die deutsche Prophetin – wird in den Stand einer Heiligen erhoben. Somit kann sie offiziell als Heilige der Universalkirche angerufen werden. Hervorgehoben wird in dem Heiligsprechungsdekret unter anderem Hildegards enge Verbundenheit mit Christus, aus der ihre geistige Fruchtbarkeit entspringt, welche „ihre Zeit erleuchtete und sie zu einem unvergänglichen Vorbild der Wahrheitssuche und des Dialogs mit der Welt machte“ (Papst Benedikt XVI., Heiligsprechungsakte).5
Noch im selben Jahr, am 7. Oktober 2012, ernennt Papst Benedikt XVI. die Heilige zur Kirchenlehrerin. Damit ist Hildegard eine von nur vier Frauen (neben mehr als 30 männlichen Kirchenlehrern), die mit dem Titel doctor Ecclesiae für ihre hervorragenden Leistungen innerhalb der kirchlichen Lehrtradition geehrt wird.

Kloster Eibingen – Nach einer wechselvollen Geschichte wird das Kloster 1802 im Zuge der Säkularisation aufgehoben und verliert somit sämtliche Besitzungen. Der einstmals quadratische Gebäudekomplex wird in der Folge zerstört. Über der einstmaligen Klosterkirche steht heute die Pfarrkirche Eibingen. In ihr befindet sich der Hildegard-Schrein, dessen Echtheit 1857 nachgewiesen werden konnte.

Abtei St. Hildegard in Rüdesheim/Eibingen – An das 1802 aufgelassene und später abgerissene Kloster Eibingen erinnert die 1904 errichtete Abtei St. Hildegard, wo heute inmitten der Weinberge noch fast 60 Benediktinerinnen das geistige Erbe ihrer berühmten Vorgängerin weitertragen.
Neben der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem literarischen und künstlerisch-musikalischen Vermächtnis der Hildegard von Bingen führen die Ordensfrauen unter anderem einen gut sortierten Buchladen, in dem neben dem reichen Angebot an Literatur auch Kunstgegenstände verschiedenster Genres verkauft werden.
Wein aus eigenem Anbau (aufgrund hervorragender Qualität mehrfach prämiert) kann zusammen mit anderen Edelweinen bzw. Getränken sowie allerlei kulinarischen Spezialitäten in einem kleinen Laden entlang der Frontfassade verkostet und erworben werden. Auch eine Goldschmiede und ein Keramikatelier sowie eine Restaurationswerkstätte für kirchliche Archivalien befinden sich innerhalb der weitläufigen Klostermauern. Ein Gästetrakt beherbergt Frauen und Männer, die sich für einige Zeit zurückziehen möchten, um sich der Stille und inneren Sammlung hinzugeben. Die Gebetshoren und liturgischen Angebote der geistlichen Schwestern stehen für Gäste des Klosters sowie für Besucherinnen und Besucher von auswärts offen.
Bei den Feierlichkeiten rund um die Ernennung Hildegards zur „Lehrerin der Universalkirche“ würdigte Papst Benedikt die mittelalterliche Benediktinerin als Frau mit einem „prophetischen Geist“ und einer „ausgeprägten Liebe zur Schöpfung“. Beim Festakt verwies er unter anderem auf ihren „wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Kirche ihrer Zeit“ sowie auf ihre „herausragende Lehre“. Ihre beachtlichen Verdienste auf dem Gebiet der Glaubensweitergabe stellen eine der insgesamt vier Bedingungen dar, die für eine Erhebung zur Kirchenlehrerin erfüllt sein müssen. Der deutsche Papst würdigte die Benediktinerin als eine Frau von „lebhaftiger Intelligenz“ und „tiefer Sensibilität“, die als „anerkannte geistliche Autorität“ immer eine „große und treue Liebe“ zu Christus und der Kirche bewahrt habe.
Hildegards literarische Hinterlassenschaft
Neben ihren Zuständigkeiten als geistliche Leiterin zweier Schwesternkonvente und zugleich als Verwalterin zweier Klosteranlagen findet die Äbtissin erstaunlicherweise auch noch Zeit für schriftstellerische Tätigkeiten. Hildegard versucht ihrer Berufung als Seherin und Prophetin gerecht zu werden, indem sie ihre Visionen – die enorme Fülle des Gehörten und Geschauten – in Worte kleidet und in der Folge möglichst vielen Menschen zugänglich macht. Der lateinkundige Mönch Volmar steht ihr dabei als Sekretär und wohl auch als geistlicher Berater zur Seite. Er versteht es, die vielbeschäftigte Äbtissin immer wieder zum Weiterschreiben zu ermutigen. Bis zu seinem Tod im Jahre 1173 bleibt er ihr ein treuer Weggefährte. Über viele Jahre bemüht sich Volmar, Hildegards mangelhaftes Latein zu verbessern, ohne dabei inhaltliche Änderungen an ihren Texten vorzunehmen.
Schon zu Lebzeiten Hildegards hat der fromme und gelehrte Mönch mit den Aufzeichnungen einer Hildegard-Vita begonnen. Nach seinem Tod übernimmt Mönch Gottfried seine Aufgaben als Sekretär und Propst im Kloster Rupertsberg. Von ihm stammt der Großteil der Vita der hl. Hildegard. Seine Aufzeichnungen werden später – kurz nach Hildegards Tod – von Theoderich, einem Mönch aus Echternach, für die Abfassung seiner Vita s. Hildegardis Virginis benützt. In diesem Werk finden sich auch autobiografische Fragmente, die Hildegard zwischen 1167 und 1169 verfasst haben dürfte. Nach dem frühen Tod Gottfrieds lässt sich Wibert von Gembloux, ein Bewunderer Hildegards aus den Niederlanden, von seinem Kloster freistellen, um die für ihn ehrenvolle Aufgabe als Sekretär auf dem Rupertsberg zu übernehmen. Auch Wibert – ein überdurchschnittlich gebildeter Mönch – hat während seiner Jahre in Hildegards Kloster mit dem Verfassen einer Vita begonnen. Diese ist zwar Fragment geblieben, wurde aber in die von Theoderich zusammengestellte Vita eingearbeitet.
Bei einer Vita handelt es sich nicht um eine vollständige (historische) Dokumentation eines Lebensweges, sondern um eine bewusste Auswahl von staunenswerten Begebenheiten aus dem Leben eines Heiligen bzw. einer Heiligen. Angesichts der manchmal etwas überzeichneten Beschreibungen ihres Lebensweges sollte die Äbtissin als geistbegabte und charismatische Persönlichkeit in die Geschichte eingehen. Insofern soll eine Vita auch zur Erbauung der Leserschaft und zum Lobpreis Gottes beitragen. Darüber hinaus leistet sie einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zu einer Heiligsprechung.

Skulptur der hl. Hildegard, Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen, Bronze von Karl-Heinz Oswald.
Die Äbtissin wird als Frau mit einer schmalen, zerbrechlichen Gestalt und hagerem Gesicht dargestellt. Ihre geschlossenen Augen könnten innere Sammlung, konzentriertes Nachdenken oder kontemplatives Betrachten ausdrücken.
Hildegards umfangreicher Briefwechsel, der sich über 33 Jahre erstreckt, bezeugt das große Vertrauen und Ansehen, das Hildegard innerhalb der verschiedensten gesellschaftlichen Schichten genießt. Hochrangige Persönlichkeiten wie Päpste, Kardinäle, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen sowie weltliche Würdenträger bis hinauf zu den Kaisern Friedrich Barbarossa und Konrad wenden sich an die geistbegabte Nonne vom Rupertsberg, um von ihr Rat und Hilfe in unterschiedlichsten Angelegenheiten zu erhalten. Die lange Liste an Adressatinnen und Adressaten lässt auf den hohen Bekanntheitsgrad der Äbtissin vom Rupertsberg schließen. Auch Gräfinnen und Fürstinnen, ja sogar die griechische Kaiserin und die englische Königin finden sich unter ihnen. Nicht selten wird von der visionär begabten Nonne ein prophetisches Wort, eine weise Beurteilung in wichtigen politischen oder persönlichen Angelegenheiten erbeten – manchmal auch vor wichtigen Entscheidungen.
Die zahlreichen Briefe an Hildegard bleiben nicht unbeantwortet: Neben ihren vielen anderen Verpflichtungen bemüht sich Hildegard, die Wünsche und Fragen all derer zu beantworten, die sich vertrauensvoll an sie wenden. Viele Menschen bitten um ihre Fürsprache bei Gott oder um Trost in ihren unterschiedlichen Bedrängnissen.
Hildegard – die Heilkundige
Im Prolog ihres zweiten Visionsbuches Der Mensch in der Verantwortung erwähnt Hildegard, dass sie zwischen 1151 und 1158 eine Schrift mit dem lateinischen Titel Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum verfasst hat. Es handelt sich um ein Buch von dem inneren Wesen der verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Von diesem naturheilkundlichen Sammelwerk existieren nur noch spätere Abschriften. Diese hinsichtlich ihrer Überlieferungsgeschichte jüngeren Handschriften sind im Gegensatz zum Original nicht mehr als ein einheitliches Ganzes erhalten, sondern sie liegen uns heute in zwei Teilen vor: einerseits das Buch Physica (übersetzt: Die Heilkraft der Natur) und andererseits Causae et Curae (Über die Ursachen und die Behandlung von Krankheiten).
In diesen beiden Werken leuchtet eine tiefgründige Kenntnis von Mensch und Natur – gleichsam der gesamten Schöpfung – auf. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten auf den Gebieten der Heil- und Naturkunde erhält Hildegard von Bingen später den Ehrentitel der „ersten deutschen Naturforscherin und Ärztin“. Hildegards große Kenntnis und Wertschätzung der Natur spiegelt sich auch in ihrer Dichtung wider. Pflanzen, Tiere und Edelsteine erhalten in den bildreichen Texten und Liedern häufig eine symbolische Bedeutung. Damit weisen sie in ihrer Vielfalt auf heilsgeschichtliche Zusammenhänge hin.

Rupertsberger Kodex
Der Rupertsberger Riesenkodex ist eine Art „Gesamtausgabe“ von Hildegards Werken. Mit der Arbeit an dieser Handschrift dürfte im Kloster Rupertsberg noch zu Lebzeiten der Äbtissin begonnen worden sein. Außer den natur- und heilkundlichen Schriften sind alle von Hildegard verfassten Werke enthalten. Der Kodex umfasst 481 Blatt Pergament, ist 46 cm x 30 cm groß und wiegt 15 kg. Er wird unter der Bezeichnung H 2 in der Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain verwahrt.
Auf dem hier abgebildeten Blatt 317 beginnt die Vita Sanctae Hildegardis, die von den Mönchen Gottfried und Theoderich verfasste Lebensgeschichte.
Klöster waren im Mittelalter bekanntlich die Anlaufstellen und medizinischen Versorgungsstätten für Kranke und Hilfesuchende. Die größeren von ihnen waren mit Kräutergärten und eigenen Behandlungszimmern ausgestattet. Das medizinische Know-how wurde über die Jahrhunderte an die für die Krankenbetreuung zuständigen Mönche oder Nonnen weitergegeben. Vielfach verfügten die Klöster bereits über medizinische Standardwerke, die häufig mit persönlichen Kommentaren hinsichtlich der Wirksamkeit der angeführten Arzneien ergänzt wurden. So wurde von passionierten Ordensbrüdern oder -schwestern nicht selten eigenes Erfahrungswissen in die Bücher eingefügt und auf diese Weise weitergegeben und verbreitet.
Hildegard selbst ist – wie sie immer wieder in ihren Schriften und Briefen zum Ausdruck bringt – engstens mit Krankheit und körperlichen Beeinträchtigungen sowie mit Schmerzen vertraut. Gerade aus dieser eigenen Betroffenheit heraus weiß Hildegard verhältnismäßig gut über die Bedürfnisse und Botschaften des Körpers Bescheid.
Auch die Abgründe der menschlichen Seele sind Hildegard als Seelsorgerin nicht unbekannt. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und innere Unruhe gehören ebenso zum Menschsein wie Freude und Zuversicht, Wohlbefinden oder Kreativität. Ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit Krisen, mit äußeren oder inneren Widerständen, mit Leiden, Krankheit und Scheitern haben die Benediktinerin innerlich reifen lassen. In ihrer Not und Bedürftigkeit hat sie sich vertrauensvoll, manchmal auch verzweifelt an Gott gewandt und von ihm Hilfe und Kraft zum Durchhalten erfleht. Hin und wieder hat sie auch Menschen ihres Vertrauens ersucht, für sie zu beten. So schrieb sie zum Beispiel an Philipp von Park, einen befreundeten Abt: „Ihr aber … schenkt mir Eure Gebetshilfe, damit ich in der Gnade Gottes verharre. Denn noch immer liege ich – wie Ihr es persönlich gesehen habt – auf meinem Krankenlager. Und da ich keinerlei Sicherheit in mir zurückbehalte, habe ich all meine Hoffnung und mein ganzes Vertrauen einzig auf die Barmherzigkeit Gottes gesetzt.“6
In Liebe und Geduld versucht Hildegard, auf die Bitten und Anliegen ihrer Mitmenschen einzugehen und ihnen nach Möglichkeit zu helfen. Mit ihrem erstaunlichen Heilwissen, das in erster Linie ihrer Intuition und ihrer langjährigen Erfahrung mit Klostermedizin entspringt, weiß sie den verschiedensten Symptomen körperlicher und seelischer Krankheiten zu Leibe zu rücken. Sowohl auf dem Disibodenberg als auch im Kloster Rupertsberg werden Kranke gepflegt und umsichtig betreut. In ihrer Vita wird Hildegard zusammen mit den ihr anvertrauten Schwestern für ihre vorbildhafte Hingabe Armen, Schwachen und Kranken gegenüber gewürdigt. Ein Dienst, der in besonderer Weise mit der Ordensregel des hl. Benedikt (verfasst um 540 n. Chr.) im Einklang steht.7
Darmowy fragment się skończył.